|
>> zurück zum Inhaltsverzeichnis und zur Auswahl der Kapitel |
3. Die unendliche Arbeit an Welt und Produktion
Im Konstruktivismus steckt der Begriff der Konstruktion, der im Alltagsverständnis oft mit Bauwerken assoziiert wird. Etwas Erbautes ist ein Konstrukt von Hand- und Kopfarbeit, etwa wenn Menschen ein Haus erstellen. Es setzt dies einen Plan, eine Konstruktion im Kopf und eine Ausführung mittels physischer Energien voraus. Im einfachsten Fall wird drauf los gebaut, werden Versuch und Irrtum genutzt, um sich eine vorübergehende Bleibe, ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. Oder man nutzt die Konstruktionen der Natur, die als Ort der Geborgenheit umfunktioniert werden. Not macht allemal erfinderisch, sie passt sich den Dingen an, die vergegenständlicht vorliegen. Aber je aktiver sich das menschliche Bewusstsein aus der vorgängigen Mächtigkeit einer Natur löste, je mehr Menschen selbstbewusst auf dem Planeten zu agieren lernten, um so bedeutsamer wurde die aktive Konstruktion, die nichts einer Vorgängigkeit der Natur überlässt, sondern sich selbst als Naturmacht entfaltet. Die Menschen lernen aus ihren Erfahrungen. Sie lernen, soweit es zu ihrer Zeit und zu ihren Bedürfnissen passt. Imaginationen heften sich an die Konstruktionen und eilen ihnen voraus. Die Kategorien Nützlichkeit oder Passung (Viabilität) sind zwar treffend, um diese konstruktiven Vorgänge zu erfassen, aber sie sind im Blick auf das Imaginäre auch zu einfach. Pyramiden, Kirchen und andere ungeheuerliche Bauten atmen einen konstruktiven Geist, der mehr will, als sich eine bloße Bleibe zum kurzfristigen Verweilen eines viablen Menschenlebens in der Natur zu schaffen. Die Unterscheidung von Bauen als direkter Konstruktion und Theorien des Bauens bzw. des Erbauten eröffnet einen Zugang zu einer verdoppelten konstruktiven Welt, die sich in Theorie und Praxis scheidet. Beide Welten schwanken zwischen Imagination und symbolischer Vergegenständlichung, beide bereichern sich gegenseitig, ohne sich je in der anderen aufzulösen. Architektur ist etwas anderes als Häuser, auch wenn sie ohne Häuser unanschaulich bliebe. Bestehende Häuser aber sind nie die Zusammenfassung aller möglichen Architektur. Nur ein Beobachter allerdings, der es sich gestattet, in beide Richtungen zu blicken, wird hier Differenzen bemerken, Unterscheidungen, die neue Unterschiede im Beobachten provozieren. Und blickt dieser Beobachter in seinen oft selbstverständlich erscheinenden Beobachtungen auf sich selbst, dann bemerkt er sich in dem ähnlichen Dilemma wie der Architekt gegenüber seinen Theorien und Vergegenständlichungen: Es ist ein Schwanken zwischen der Selbstformulierung einer Beobachtung und dem Übersteigen dieser Formulierung durch einen unterscheidenden Blick oder ein unterscheidendes Wort. Das Beobachten selbst gerät ständig in den Fluss von Perspektiven. Architektur und Beobachtertheorien sind dann nicht mehr als der Versuch, hierfür eine Statik, ein Gerüst, eine Ordnung, d.h. eben eine Konstruktion zu entwerfen. Allerdings verliert man im Fluss leicht den Überblick und läuft Gefahr zu ertrinken.
All der Materialismus der Vergegenständlichungen von Konstruktionen ist nun aber die große Befriedigung wie auch Täuschung des konstruktiven Tuns. Es ist Befriedigung, soweit sich Bedürfnisse an die Konstruktionen heften, die neue Bedürfnisse produzieren und so zu einer unendlichen Fülle von Wechselwirkungen im Zirkel des zu befriedigenden Lebens führen. Dabei ist Befriedigung selbst unerreichbar, weil sie ein Spannungsverhältnis zwischen Subjekt und Welt darstellt, das, wenn es je zu einem Ende käme, nur noch als reine Lust oder als Tod vorstellbar ist. Als Beobachter wissen wir, dass jede Lust zeitlich begrenzt bleibt, und der Tod Grenze jeder individuellen Befriedigung ist. Zur Täuschung wird die Vergegenständlichung hingegen in ihrem Versprechen, dass uns unsere Konstruktionen irgendwann einmal tatsächlich zu einem befriedigenden Ende kommen lassen, an dem letztlich alles gerichtet ist.
3.1 Was ist die reale Welt und die reale Produktion?
Die Bestimmung einer realen Welt und einer realen Produktion ist eine Schlüsselstelle moderner Erkenntnistheorien. Sie sind von der Intention geleitet, diese Bestimmung rational darzulegen, zu differenzieren, und damit die Legitimität der eigenen Aufklärung über die Welt und das Wesen der Produktion zu dokumentieren.
Kaum deutlicher kann das Dilemma der Intentionalität des Erkennens, das begrifflich (sprachlich) vermittelt ist, diskutiert werden, als an der Einheit der drei Kritiken der reinen Vernunft, der praktischen Vernunft und der Urteilskraft von Immanuel Kant. Seine Konstruktion ist sehr aufschlussreich. Obwohl der Konstruktivismus die ontologisierende Betrachtungsweise nicht teilt, zeigt Kant doch anschaulich ein Beobachtermodell (und ein implizites Teilnahmemodell) auf, in das wir bis in die Gegenwart geraten sind und auf das wir immer wieder zurückfallen. Deshalb will ich mich zunächst kurz mit Kant auseinandersetzen, um seine Bedeutung für den Konstruktivismus an dieser Stelle zu markieren.
Nachdem Kant das Erkenntnisvermögen für Naturbegriffe vor allem in seiner Kritik der reinen Vernunft und das der Freiheitsbegriffe in seiner Kritik der praktischen Vernunft dargelegt hatte, ergab sich ihm folgendes Dilemma: Der Verstand als das Vermögen überhaupt, Erkenntnisse zu gewinnen, der einerseits über formale Gesetze a priori verfügt, die dem Menschen vor aller Erfahrung eingeboren sind (die Anschauungsformen Raum und Zeit und die Kategorien, wie Kant meint) und andererseits aufgrund und im Rahmen dieser Bedingung der Möglichkeit von Erfahrungen diese empirisch synthetisiert, dieser Verstand und die Vernunft, die ihrerseits ein a priori des sittlichen Handelns im kategorischen Imperativ (Sittengesetz) kennt, beziehen sich zwar beide auf den Boden der Erfahrung, aber sie bedingen sich nicht gegenseitig: „Denn so wenig der Naturbegriff auf die Gesetzgebung durch den Freiheitsbegriff Einfluss hat, eben so wenig stört dieser die Gesetzgebung der Natur.“ (Kant 1977, X, 82) Daraus ergibt sich für Kant: „Der Verstand ist a priori gesetzgebend für die Natur als Objekt der Sinne, zu einem theoretischen Erkenntnis derselben in einer möglichen Erfahrung. Die Vernunft ist a priori gesetzgebend für die Freiheit und ihre eigene Kausalität, als das Übersinnliche in dem Subjekte, zu einem unbedingt-praktischen Erkenntnis. Das Gebiet des Naturbegriffs, unter der einen, und das des Freiheitsbegriffs, unter der anderen Gesetzgebung, sind gegen allen wechselseitigen Einfluss, den sie für sich (ein jedes nach seinen Grundgesetzen) auf einander haben könnten, durch die große Kluft, welche das Übersinnliche von den Erscheinungen trennt, gänzlich abgesondert. Der Freiheitsbegriff bestimmt nichts in Ansehung der theoretischen Erkenntnis der Natur; der Naturbegriff eben sowohl nichts in Ansehung der praktischen Gesetze der Freiheit: und es ist in sofern nicht möglich, eine Brücke von einem Gebiete zu dem andern hinüberzuschlagen.“ (Ebd., 106 f.)
Die reine Naturerkenntnis will nichts als die Notwendigkeit und Allgemeinheit dieser Erkenntnis: Wenn Gegenstände fallen, so sucht sie das Fallgesetz als notwendig und allgemeingültig entsprechend der Anschauungsformen und Kategorien a priori herauszufinden. Der Verstand erarbeitet sich diese Gesetzgebung theoretisch. Alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse werden so gewonnen.
Die praktische Vernunft zielt hingegen auf die Freiheit des Subjekts. In ihr verfährt der Mensch empirisch gesehen nach der Regel, dass das für ihn gut, nützlich, sinnvoll, erstrebenswert ist, was er will, was ihn befriedigt. Bleibt es bei einer solchen Sichtweise, dann erweist sich der Mensch jedoch als des Menschen Wolf, einer haut den Anderen über das Ohr, jeder versucht, seine Triebbegierden auf Kosten des anderen zu bereichern, so dass die Freiheit des Handelns selbst ad absurdum geführt wird. Kant versteht unter dem Sittengesetz daher ein Gebot schlechthin, einen kategorialen Imperativ, der sich in einer allgemeinen und notwendigen Maxime für alle vernünftigen Menschen niederschlagen kann: „Handle so, als ob die Maxime deines Handelns durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte.“
Hier nun wird deutlich, wie sehr Natur- und Freiheitsbegriff auseinanderfallen können. Wer nach den Gesetzen der Natur eine Atombombe konstruiert, der handelt bezogen auf seine Verstandesleistungen völlig folgerichtig. Bezogen auf die Sicht der menschlichen Freiheit mag sein Handeln hingegen als absurd anzusehen sein (vgl. dazu auch von Kant die Schrift „Zum ewigen Frieden“). Insoweit bedarf es eines vermittelnden Prinzips, um das menschliche Denken und Handeln nicht so weit auseinanderfallen zu lassen, dass es sich bloß selbst als Widerspruch hervorbringt. In seiner Kritik der praktischen Vernunft hatte Kant schon darauf verwiesen, dass es einen Primat der praktischen über die theoretische Vernunft gibt. In der Kritik der Urteilskraft legt Kant dar, dass die Urteilskraft als reflektierende für die Besonderheiten jenes Allgemeine sucht, das auch ein verknüpfendes Band zwischen Natur- und Freiheitsbegriffen herstellen hilft. Die Urteilskraft verknüpft beide Pole über das Prinzip der Zweckmäßigkeit. „Dieser transzendentale Begriff einer Zweckmäßigkeit der Natur ist nun weder ein Naturbegriff, noch ein Freiheitsbegriff, weil er gar nichts dem Objekte (der Natur) beilegt, sondern nur die einzige Art, wie wir in der Reflexion über die Gegenstände der Natur in Absicht auf eine durchgängig zusammenhängende Erfahrung verfahren müssen, vorstellt, folglich ein subjektives Prinzip (Maxime) der Urteilskraft“ (ebd., 93).
Die Annahme lautet hier a priori, dass die Urteilskraft, aus Gründen, die wir nicht kennen, eine gesetzliche Einheit des Mannigfaltigen uns ermöglicht, und ohne diesen Leitfaden wären wir verloren. Denkbar ist immerhin, dass die Mannigfaltigkeit der Natur so groß wäre, dass unser Verstand in den Spezifikationen der Natur gar keine Ordnung fixieren könnte, so dass die Urteilskraft in subjektiver Hinsicht zwar nicht der Natur (an sich), wohl aber dem Menschen (für sich) vorschreibt, was man als Gesetz der Spezifikation der Natur ansehen muss: „Wenn man also sagt: die Natur spezifiziert ihre allgemeinen Gesetze nach dem Prinzip der Zweckmäßigkeit für unser Erkenntnisvermögen, d.i. zur Angemessenheit mit dem menschlichen Verstande in seinem notwendigen Geschäfte: zum Besonderen, welches ihm die Wahrnehmung darbietet, das Allgemeine, und zum Verschiedenen (für jede Spezies zwar Allgemeinen) wiederum Verknüpfung in der Einheit des Prinzips zu finden: so schreibt man dadurch weder der Natur ein Gesetz vor, noch lernt man eines von ihr durch Beobachtung (ob zwar jenes Prinzip durch diese bestätigt werden kann).“ (Ebd., 95 f.)
Die Natur mag also in ihren Gesetzen eingerichtet sein wie sie will, die reflektierende Urteilskraft aber will, dass sie nach dem Prinzip der Zweckmäßigkeit durchforscht wird, „weil wir, nur so weit als jenes Statt findet, mit dem Gebrauche unseres Verstandes in der Erfahrung fortkommen und Erkenntnis erwerben können.“ (Ebd., 96)
Das Prinzip der Zweckmäßigkeit bedeutet, dass wir uns eine Vorstellung von Natur missfallen lassen würden, die geringe Voraussagen bietet und durch Heterogenität ihrer Gesetze charakterisiert ist, auch wenn wir unter Umständen uns öfter damit zufrieden geben müssen, eine Mannigfaltigkeit nicht unter ein Prinzip vereinigen zu können (vgl. ebd., 98). Zusammenfassend heißt es bei Kant:
„Der Verstand gibt, durch die Möglichkeit seiner Gesetze a priori für die Natur, einen Beweis davon, dass diese von uns nur als Erscheinung erkannt werde, mithin zugleich Anzeige auf ein übersinnliches Substrat derselben; aber er lässt dieses gänzlich unbestimmt. Die Urteilskraft verschafft durch ihr Prinzip a priori der Beurteilung der Natur, nach möglichen besonderen Gesetzen derselben, ihrem übersinnlichen Substrat (in uns sowohl außer uns) Bestimmbarkeit durch das intellektuelle Vermögen. Die Vernunft aber gibt eben demselben durch ihr praktisches Gesetz a priori die Bestimmung; und so macht die Urteilskraft den Übergang vom Gebiete des Naturbegriffs zu dem des Freiheitsbegriffs möglich.“ (Ebd., 108)
Welche Gründe gibt es also a priori, die Zweckmäßigkeit als Prinzip zu sehen, das bei einer Betrachtung der Natur als Ganzem fungiert?
Aus der Verstandestätigkeit ergeben sich zwar die allgemeinen Formen der Naturgesetzmäßigkeit, denen sich die besonderen Gesetze unterordnen, aber dies kann nicht unvermittelt gedacht werden. Der Inhalt der Besonderungen ist empirisch, und es ist für die beobachtende Vernunft des Menschen nicht eindeutig zu ergründen, warum es dieser und kein anderer Inhalt ist. Auch wenn Kant in seinem Alter versucht hat, die reine Naturerkenntnis als Basis aller Wissenschaften zu formulieren, so ist ihm ein plausibler Übergang von der Metaphysik zur Physik nicht gelungen. Wenn er meint, dass als eigentliche Wissenschaft nur die genannt werden kann, die apodiktisch ist – und der Chemie den Status der Wissenschaft aberkennen will, weil sie zu empirisch verfährt (vgl. Kant 1977, IX, 12), dann versucht er die unmögliche Fixierung dieses Inhalts eben doch. Die Besonderheiten der Natur erweisen sich jedoch als empirische Basis aller Urteilssetzungen, der die Zweckmäßigkeit als Schema bleibt, um sich nicht dem Chaos zu überlassen. Das Besondere der Natur erweist sich damit als zweckmäßig, nimmt gleichsam Rücksicht auf unsere Erkenntnis, indem es sich unter die A-priori-Formen unseres Verstandes einordnen lässt und ein für uns sinnvolles Ganzes ergibt.
Der höchste Zweck aus der Sicht der praktischen Vernunft ist das Sittengesetz, das die menschliche Freiheit auf den Begriff bringt und vermittelt über die Zweckausgerichtetheit der Urteilskraft das Weltganze in einer gerichteten Weltordnung versöhnt.
Der Mensch erscheint hier zwar immer noch als eine Art labyrinthhaftes Wesen, aber die Konstruktion des Labyrinths ist keine vordergründige Konstruktionsaufgabe durch den Menschen selbst, sondern eine durch die Natur a priori gegebene Ordnung, in der auch die Freiheit auf die Pflicht der Wahrnehmung ihrer a priori gegebenen Sittlichkeit zurückverwiesen wird. Kants Weltmodell der Erkenntnis ist voller Zuversicht für die bewusste Bewältigung aller Irrwege durch die Systematisierung der Erkenntnisvermögen des Verstandes, der Urteilskraft und der Vernunft, indem der Verstand die Gesetzmäßigkeiten der Natur erfasst, die Urteilskraft die Zweckmäßigkeiten aller Prozesse der Kunst und teleologischer Naturauffassung nachweist, die Vernunft ihren Endzweck in der Freiheit des (einschränkenden) Sittengesetzes findet. Das Labyrinth ist kein Irrweg mehr, sondern wird durch das sprachliche Kalkül der Festlegungen auf den roten Faden des Erkenntnisvermögens beschränkt, so dass nur noch Abweichungen vom festgelegten Gang als Abirrungen erscheinen mögen. Die Rationalität vertraut nicht auf die Liebe oder den Glauben, sondern einzig auf das begründete Wissen, das durch eine Reflexion des Subjektes in sich selbst erzeugt werden kann. Die Selbstreflexion dieser transzendentalen Methode löst damit die Schleier und Nebel der Gefährdungen durch Selbstbezug auf, was sich letztlich im versöhnenden Gedanken der Zweckmäßigkeit mit sich selbst beruhigt. Dabei bleibt jedoch in der Suche nach reiner Begründung vor aller Erfahrung die Reflexion auf die Zweckmäßigkeit des eigenen gewählten Standpunktes der Begründung unhinterfragt, da er hier in das Schema der a priori vorhandenen Welt eingeborener Verstandeskategorien und Anschauungsformen, von Sittengesetz und Zweckmäßigkeit in sich selbst zurückverlegt werden kann. So bleibt jedoch die Ungeheuerlichkeit des ganzen Gebäudes selbst zwar nicht ohne Namen, wohl aber ohne Begründung des zeitgebundenen Zweckes. Bei Naturvölkern z.B. ist beobachtbar geworden, dass sie in ihren Sprachen aus ihrer Lebenspraxis heraus Zwecke in die Natur projizieren, die sie sprachlich in Namen fixieren. Darin unterscheidet sich das Vorgehen Kants nur im Abstraktionsgrad von der Ordnungssuche eines beliebigen Naturvolkes. Bei beiden bleibt die Begründung der Ordnungsvorstellung selbst unhinterfragbar: einerseits werden ganz natürlich Begriffe gebildet und in der Lebenspraxis gesetzt, andererseits werden sie künstlich durch Abstraktion von der Lebenspraxis gesetzt; eine historische Distanzierung ist für beide Vorgehensweisen nicht erforderlich.
Kant wäre allerdings im Recht, wenn es sich nachweisen ließe, dass der Mensch in seinem Erkenntnisvermögen a priori von Strukturen ausgehen muss, die die Außenwelt objektiv nur in bestimmter Weise empfinden und wahrnehmen lassen. Hierin liegt in der Tat eine wesentliche Erkenntnisleistung Kants, die wir aus der Sicht der heutigen Naturwissenschaften in mannigfacher Hinsicht konkretisieren und differenzieren können. Allerdings ist Kant andererseits über das Ziel hinausgeschossen, weil er von einem zu begrenzten Fundament der Erfahrung ausging, um sein Modell zu begründen. Besonders Hegel hat in konsequenter Fortführung die ahistorische Betrachtungsweise aufgegeben und die Ebene der bloß beobachtenden Vernunft verlassen. Dies soll uns hier nur sehr reduziert in einer Hinsicht interessieren. Bei Kant erscheinen der Verstand, die Vernunft und die Urteilskraft als allgemeine Gesetzlichkeiten der menschlichen Natur, Hegel hingegen versucht sie als begriffene und historisch geronnene Objektivationen erst herzuleiten, bevor er sie setzt. Bei dieser Herleitung zeigt es sich, dass der bürgerliche Mensch Natur und Freiheit wohl über eine Zweckmäßigkeit vermittelt, dass aber diese Zweckmäßigkeit selbst kein überhistorisches Prinzip darstellt, sondern Ausdruck eines Gewordenseins und Werdens ist.
Dabei greift für Hegel der Begriff des Tuns in entscheidender Weise in die Selbstbewusstwerdung der Vernunft ein: „Das Individuum kann daher nicht wissen, was es ist, ehe es sich durch das Tun zur Wirklichkeit gebracht hat.“ (Hegel 1970, 3, 297) Hier nun scheint es den Zweck seines Tuns nicht bestimmen zu können, ehe es nicht schon getan hat, obwohl es andererseits den Zweck seiner Handlung vor sich haben muss, wenn es tun will. Betrachtet man es differenzierter, so zeigt sich die Handlung als ein Gemisch von Umständen, Zwecken, Mitteln und Werken, die das Individuum produziert und zugleich als Voraussetzung seiner Produktionen vorfindet. Im Werk vergegenständlicht sich das Individuum, so dass es über das Werk sich vergleichen und von Anderen unterscheiden kann. An dem Werk entsteht im Vergleich jedoch die Differenz von Tun und Sein, das Individuum versachlicht seine Bezüge zu anderen Menschen über seine Produktionen. Doch diese Versachlichung mündet in die Konstruktion eines Labyrinths, in dem man sich total verirren kann, weil die Sache nicht die Sache ist, als die sie erscheint: „Eine Individualität geht also, etwas auszuführen; sie scheint damit etwas zur Sache gemacht zu haben; sie handelt, wird darin für andere, und es scheint ihr um die Wirklichkeit zu tun zu sein. Die anderen nehmen also das Tun derselben für ein Interesse an der Sache als solcher und für den Zweck, dass die Sache an sich ausgeführt sei, gleichgültig, ob von der ersten Individualität oder von ihnen.“ So zeigen sie sich gegenseitig, dass die Sachen schon ausgeführt sind oder geben Hilfen, aber insgesamt täuschen sie sich alle selbst an dem Vorgang: Es ist je das individuelle Tun und Treiben, was „bei der Sache interessiert, und indem sie innewerden, dass dies die Sache selbst war, finden sie sich also getäuscht.“ (Ebd., 308) Aber auch wenn sie tun oder sogar helfen, so ist diese Täuschung ebenso vorhanden: Denn auch sie betrügen die Anderen auf diese Weise. Der Betrug liegt darin, dass es die reine Sache gar nicht gibt, sondern dass sie uns täuscht. Wenn jemand einen Gegenstand produziert, dann scheint er an dieser Gegenständlichkeit zunächst selbst interessiert, aber auf dem Warenmarkt reduziert sich sein Interesse auf die Realisierung des Geldwertes. Ein derartiges Beispiel illustriert in aller Deutlichkeit das Auseinanderfallen von Tun und Sein, von Sache und Interesse.
Die sichere Welt der Kantschen Begrifflichkeiten ist hier verflüssigt, die Zweckmäßigkeit differenziert sich in unterschiedliche Interessenrichtungen, sie bezieht sich auf historische und gesellschaftliche Vorgänge. Diese Vorgänge zeigen ihrerseits die Nichtrealisation des Sittengesetzes, das nach Kant a priori in uns liegen sollte und dem nur ein aufgeklärtes Zeitalter folgen könnte. Die historische Sicht eines gegenwärtig ernüchterten Beobachters weist demgegenüber nach, dass sich aufklärendes Wissen und reales Tun und Sein, Sachen und Interessen bloß theoretisch harmonisieren lassen. Das Labyrinth der Welt erscheint nunmehr als Möglichkeit der Verirrungen in die unterschiedlichen Interessenlagen der Menschen selbst, in ihre Entfremdungen voneinander, die nicht durch sprachliche, naturgegebene Unterschiede am meisten befördert werden, sondern durch das Tun der Menschen im gesellschaftlichen Prozess der Produktion und Reproduktion ihres Lebens. Die Warenmärkte der Welt zeigen das wechselseitige Chaos an, den Kampf aller gegen alle, der das Mittel (Geld) zum Zweck verdreht hat, die Verflüssigung der Sitten, die Veränderbarkeit der Natur, die Ausnutzbarkeit der Technik, die Zerstörungskraft der Einsicht in Naturzusammenhänge.
Die Verflüssigung der Begriffe entspricht der Wandlung der Welt, der inneren Dialektik von Aneignung und Entäußerung, die der Mensch agiert und reagiert. Demgegenüber gilt für die Aussagen von Kant, sofern er Anschauungsformen und Kategorien a priori zu fixieren sucht, eine hohe Formalität des Anspruches, die die inhaltliche Differenziertheit im temporalen Kontext aufgrund eines mangelhaften Geschichtsverständnisses einbüßt, um mit einer quasi naturwissenschaftlichen Gesetzesschau zu entschädigen. Aber die erstrebte Universalisierung scheitert zu leicht daran, dass die Analyse eben nie so weit getrieben werden kann, wie es erforderlich wäre, wenn sich der Interpret Kant durch Verallgemeinerung des logischen Schlusses schließlich nur die scheinbar reinen Formen übrigbehält, die unserer Natur an sich entsprechen sollen, obwohl wir als Beobachter so gebaut sind, dass wir Dinge an sich gar nicht erkennen können. Die Dialektik realer und begrifflicher Verhältnisse, diese eigenartige und widersprüchliche Synthesis, überfordert unser Denken durch die Verflüssigung, die im geschichtlichen Wandel selbst enthalten ist und auch in den Begriffen ist, die alles auf den Begriff bringen sollen.
Diese längere Einleitung zeigt an, dass der Konstruktivismus sich nicht naiv Zweckmäßigkeitsgeboten im nachkantianischen Sinne – etwa bei der Definition von Viabilität – unterwerfen kann. Einerseits sind solche Zweckmäßigkeitsüberlegungen im Blick auf die Aufgaben von Verständigungsgemeinschaften immer zutreffend. Dies betrifft die grundlegende Beobachterposition: Will ich Funktionen in der Natur oder Gesellschaft gezielt beobachten, dann benötige ich ein Kriterium der Beobachtung. Hier bietet sich die Passung (Viabilität) als sehr allgemeines Konstrukt an: Etwas passt zu dem Zweck, den es beabsichtigt, oder es passt nicht. Andererseits ist dies aber nun eine entschieden vereinfachte Beobachtung, denn als Beobachter zwinge ich mich in Ausschließungen, indem ich bestimmte Interessenlagen, Machtpositionen, historische Begebenheiten usw. hervorhebe und andere vernachlässige. Zweckmäßigkeit selbst ist ein kognitives Ordnungskonstrukt, das selbst Voraussetzungen impliziert, die auch im allgemeinen Ausdruck der Viabilität erscheinen. Wann passt denn etwas für einen Beobachter? Seine Konstruktion von Realität umfasst ein weites Spektrum an Ordnungen. Da sich ein Labyrinth von Welt meist leichter mythisch und in vieldeutigen Bildern präsentieren lässt, wird der exaktere Beobachter gezwungen, das Weltbild zu vereinfachen. So sucht er nach der Struktur, nach der Funktion, nach dem Apriori, das alles in einem zu enthalten scheint, um auf lange Sicht durch andere Beobachter enttäuscht zu werden: In dieser Konstruktion von Struktur wurde jene übersehen, bei dieser Funktion wurde eine andere nicht bedacht, im Apriori machte sich a posteriori etwas ganz anderes bemerkbar.
An der bisherigen Gedankenentwicklung können wir rekonstruktiv verfolgen, dass die Auseinandersetzung mit symbolischen Vorgaben unserer Kultur im 19. Jahrhundert eine Veränderung im Bewusstsein durchmachte, wenn wir die Bewegung von Kant auf Hegel dafür nehmen wollen. An die Seite einer rein kognitiven Bedenklichkeit rückt nun auch die Beobachtung eines Tuns, eines konstruktiven Handelns. Besonders John Dewey, inspiriert durch hegel, hat dies konsequent in seine pragmatische Handlungstheorie umgesetzt. Dies verändert radikal die Beobachtung der realen Welt. Ist sie schon bei Kant nur ein Ding an sich, zu dem wir erst durch unser aktives Denken (bei einem vorgegebenen Vermögen) Zugang finden, so werden nunmehr auch die denkerischen Konstruktionen in den Zusammenhang mit Handlungen, mit einem Tun oder Machen gestellt. Ziel und Prozedur bleiben zwar unterschiedliche Beobachterperspektiven, aber es wird nun erkannt, dass Prozeduren selbst hinter dem Rücken der Konstrukteure bzw. Produzenten einen Rahmen für Beobachter und Beobachtungen, für Teilnahmen und Aktionen entfalten. Diese Veränderung im Bewusstsein ist eine entscheidende Voraussetzung, um überhaupt eine konstruktivistische Erkenntnishaltung einzunehmen. Erst unter dieser Voraussetzung sehen wir, dass die reale Welt ein Konstrukt von Beobachtern und Beobachtungen ist: Sowohl hinsichtlich ihrer Gegenstände als auch ihrer Prozeduren. Und wir bemerken eben aufgrund eines zunehmenden Bewusstseins für die Prozeduren, inwieweit wir als Beobachter in das Unternehmen der Konstruktion einer realen Welt teilnehmend und aktiv verstrickt sind.
Diese reale Welt verwandelt sich damit von einem Abbild der Natur, wie sie naturalistisch mitunter naiv auch heutzutage noch gedacht wird, in eine Welt realer Konstruktionen bzw. Produktionen, wie es bevorzugt im Anschluss an Marx geschieht. Marx hat stärker noch als Hegel die Konsequenz aus der geschilderten Gedankenbewegung gezogen und die menschliche Lebensform als eine durch Menschen selbst produzierte begriffen. Die Arten der Produktion unterscheiden die menschlichen Zeitalter. Aber Marx konnte es nicht gelingen, die Beobachter in der Wahrnehmung der Prozeduren zu verallgemeinern. Zwar war dies sein politisches Ziel (der Klassenkampf als Verallgemeinerung einer wahren Beobachterposition über die realen Produktionen des Kapitalismus), aber die von Marx inspirierten Bewegungen scheiterten immer wieder an den Beobachtergegensätzen, die in Gegensätzen von Macht, Interesse, ungleicher Kapitalverteilung von ökonomischen, symbolischen, sozialen, kulturellen Kapital (im Sinne Bourdieus; vgl. Kap. IV.3.3.1.1), in ungleichen Beziehungen wurzeln. So hat sich, wenn wir einen Blick auf widersprüchliche Beobachtungen der realen Welt oder der realen Produktion am Ende des 20. Jahrhunderts nehmen, die Vereinheitlichungstendenz zunehmend aufgelöst und in ein Nach- und Nebeneinander verwandelt, das von den Gegensätzen selbst angetrieben scheint. Dabei haben wir es allemal mit Modellen, mit symbolischen Konstrukten zu tun, die sich gegenständlich und/oder prozedural eine Realität erfinden, um diese ihren Zwecken anzupassen.
Aber gibt es nicht das Reale hinter dieser Realität? Ich kann und will dies nicht bestreiten. Aber ich kann ihm weder einen ontologischen Sinn noch eine beste oder letzte Beobachterposition zukommen lassen. Dieses Reale, so habe ich in den Kränkungsbewegungen in Band 1 gezeigt, ist nur unsere nachträgliche imaginäre, aber hauptsächlich symbolische Verarbeitung von unerwarteten, nicht vorhersehbaren Ereignissen, die unsere Konstruktionen immer wieder heimsuchen.
Damit zeigt sich die Notwendigkeit an, dass Beobachter in ihren Beobachtungen eine Art unendliche Arbeit an Welt und Produktion betreiben. In diesem Treiben gibt es bei Habermas, dem ich mich erneut zuwenden will, einen Versuch, durch die Unterscheidung von objektiver, sozialer und subjektiver Welt an die vorgenannten Positionen anzuschließen. Die Auseinandersetzung mit diesem Versuch soll den interaktionistisch-konstruktiven Ansatz präzisieren helfen.
3.2 Objektive, soziale, subjektive Welt als Beobachterkonstrukte?
Als vergesellschaftete Subjekte nehmen wir nach Habermas an kooperativen Deutungsprozessen teil, die ein Konzept von Welt implizit verwenden (Habermas 1988, 1, 123). Folgen wir phänomenologischen Ansätzen, dann ist in diesem Konstrukt von Welt immer schon eine intersubjektiv geteilte Lebenswelt als nicht mehr hinterfragtes Einverständnis (als kulturelle Überlieferung) konstitutiv. Schütz spricht hier z.B. im Anschluss an Husserl vom Lebenshorizont, einem unthematisch mitgegebenen Hintergrund für die kooperativen Deutungen selbst. Wird dieser Horizont thematisiert und reflektiert, dann wird der Hintergrund fragwürdig. Es eröffnen sich Teilnehmer- und Beobachterperspektiven, die wir bewusst analysieren können, um uns mit unseren Deutungen in der Welt zu situieren.
Nach Habermas sind wir in solcher Weltsituation Teilnehmer dreier Welten:
- Die objektive Welt ist sein Eingeständnis an die traditionelle Wissenschafts- und Dinglichkeitsauffassung, dass wir als Teilnehmer oder Beobachter in einer Welt sind, die wir zugleich als Bezugnahme auf das Existieren von Sachverhalten (außerhalb unserer bloßen Subjektivität) anerkennen. Dies erinnert sehr an Modelle des teleologischen Handelns (vgl. ebd., 129 ff.). Hier erscheinen zwei grundsätzliche Auffassungen von Rationalität als reflexiver Deutung von Welt: „In der einen Richtung stellt sich die Frage, ob es dem Aktor gelingt, seine Wahrnehmungen und Meinungen mit dem, was in der Welt der Fall ist, in Übereinstimmung zu bringen; in der anderen Richtung stellt sich die Frage, ob es dem Aktor gelingt, das, was in der Welt der Fall ist, mit seinen Wünschen und Absichten in Übereinstimmung zu bringen.“ (Ebd., 130) Der Aktor kann sich deutend äußern oder handelnd agieren, um durch einen Fremdbeobachter beurteilt zu werden: Wahr oder falsch, erfolgreich oder erfolglos, wirksam oder unwirksam sind dann gängige Beurteilungsmuster. Jedes zielgerichtete und strategische Handeln operiert so mit Akteuren und Beobachtern, die zugleich eine objektive Welt voraussetzen, um das zu erreichen, was sie wollen: Die Situierung in einer Welt, in der sie wahrnehmend mit Sachverhalten und Absichten gegenüber Sachverhalten handeln und reflektieren. Hier benötigen sowohl die Akteure wie die Beobachter nur diese eine Welt, die sie als Deutungsrahmen voraussetzen. Der Sinn dieser Welt besteht in einer Bezugnahme auf Sachverhalte. Diesen Teilnehmer- und Beobachtersinn als kooperative Deutung nennt Habermas objektive Welt.
- Geht es hingegen um normenreguliertes Handeln, dann passt das enge Teilnehmer- und Beobachterkonzept nicht mehr. Neben die objektive Welt tritt nun eine soziale hinzu. Die soziale Welt zeigt die Akteure als rollenspielende Subjekte, die mit anderen Akteuren interaktiv handeln. „Eine soziale Welt besteht aus einem normativen Kontext, der festlegt, welche Interaktionen zur Gesamtheit berechtigter interpersonaler Beziehungen gehören. Und alle Aktoren, für die entsprechende Normen gelten (von denen sie als gültig akzeptiert werden), gehören derselben sozialen Welt an.“ (Ebd., 132) Der Sinn dieser Welt besteht in einer Bezugnahme auf Normen, die das Handeln regulieren. Diese Normen sind Sollsätze oder Gebote, die für die Teilnehmer und Beobachter der sozialen Welt in kooperativer Deutung als gerechtfertigt gelten. Wieder erscheinen zwei Richtungen als möglich: „Im einen Fall werden Handlungen daraufhin beurteilt, ob sie mit einem bestehenden normativen Kontext übereinstimmen oder von ihm abweichen, d.h. ob sie mit Bezug auf einen als legitim anerkannten normativen Kontext richtig sind oder nicht. Im anderen Fall werden Normen daraufhin beurteilt, ob sie gerechtfertigt werden können, d.h. ob sie es verdienen, als legitim anerkannt zu werden.“ (Ebd., 134)
Ein normenreguliertes Handeln setzt beide Welten voraus: objektiv setzt sie voraus, dass die Subjekte sich auf Sachverhalte beziehen, sozial, dass sie sich mit Normen auseinandersetzen; in der Vermittlung beider Welten müssen sie faktische und normative Bestandteile in Handlungssituationen unterscheiden. Objektivierend sagen sie aus, ob etwas der Fall ist oder nicht; normativ behaupten sie, ob etwas zu Recht oder zu Unrecht geboten ist (ebd., 135).
- In den beiden bisherigen Welten nach Habermas werden die Akteure den Teilnehmern oder Beobachtern unterstellt, die sich stets auf etwas beziehen, was außerhalb der Aktionen liegt: Auf Sachverhalte oder andere Akteure, auf Wahrheiten oder Normen. In der subjektiven Welt reflektieren sie auf sich selbst, auf ihr eigenes, subjektives Erleben.
Im subjektiven Erleben erscheint ein dramaturgisches Handeln, wie es insbesondere von Goffman (1971, 1983) herausgestellt wurde. Die Teilnehmer- und Beobachterperspektive wird hier gerne mit dem Theater verglichen: Die Beteiligten bilden ein interaktives Publikum, das sich etwas vorführt, um darin beobachtet zu werden, das aber auch beobachtet, um die Beobachtungen mit allerlei (Un-)Sinn zu füttern. So erscheinen die Akteure auf einer Bühne subjektiven Erlebens, um zugleich etwas zu re/präsentieren, anerkannt zu werden, sich und Andere zu inszenieren. Nach Habermas muss sich hier der Akteur, „indem er einen Anblick von sich präsentiert, zu seiner eigenen subjektiven Welt verhalten“ (ebd., 137). Zu dieser subjektiven Welt hat er einen privilegierten Zugang. Allerdings schließt Habermas Empfindungen hier bewusst aus und bezieht sich eher auf intentionale Erlebnisse (ebd.). Sein Problem besteht ohnehin darin, diese unscharfe Welt unter ein bewusstes Muster zu fassen. „Vielleicht kann man sagen, dass Subjektives so durch wahrhaftig geäußerte Erlebnissätze repräsentiert wird“ (ebd.). Es besteht aber immer das Problem, dass solche Subjektivität im Kontext eines Publikums steht, das erst Wünsche oder Gefühle des Handelnden „als etwas Subjektives zurechnet“ (ebd.). Nun hat Habermas Schwierigkeiten, Kognitionen (Meinungen und Absichten) aus der subjektiven Welt ganz auszuschließen, aber sie gehören aufgrund ihrer Bedeutungen eher zur objektiven Welt; als subjektiv allein können sie nur gelten, wenn ihnen kein objektiver, d.h. „kein existierender oder kein zur Existenz gebrachter Sachverhalt entspricht“ (ebd., 138). Gleichzeitig wird Subjektivität aber drastisch auf ein kognitives Modell verkürzt: Sie bemisst sich „allein am reflexiven Verhältnis des Sprechers zu seiner Innenwelt“ (ebd.).
Die Außen- und die Innenweltperspektive der Akteure/Teilnehmer/Beobachter ist für Habermas sehr wichtig. Dies deckt sich in großen Teilen mit dem konstruktivistischen Konzept des Fremd- und Selbstbeobachters. Allerdings unterscheidet es sich auch deutlich im Anspruch der Unterscheidung dieser drei Welten und in der Konzentration auf das kommunikative Handeln. Dieses ist dadurch ausgezeichnet, dass die Akteure nicht mehr geradehin auf etwas in einer dieser drei Welten Bezug nehmen, sondern diesen Bezug durch die Möglichkeiten begrenzen, die die jeweilige Verständigungsgemeinschaft setzt. „Verständigung funktioniert als handlungskoordinierender Mechanismus nur in der Weise, dass sich die Interaktionsteilnehmer über die beanspruchte Gültigkeit ihrer Äußerungen einigen, d.h. Geltungsansprüche, die sie reziprok erheben, intersubjektiv anerkennen.“ (Ebd., 148) Insoweit sind die drei Welten Beobachtungsbereiche, die Habermas erhebt, die sich nach unterschiedlichen Festlegungen gegenseitig ergänzen. Habermas geht es um diese Ergänzung und Begrenzung, um das kommunikative Handeln als übergreifendes rationales Konstrukt auszuweisen. Dass es eine durchaus rationale Struktur des kommunikativen Handelns gibt, kann nicht bestritten werden. Insoweit Habermas auf symbolische Aspekte abhebt, präzisiert seine Analyse den Beobachterbereich rationaler Verständigung. Bestritten wird von mir allerdings die Ausschließlichkeit des Verfahrens ebenso wie seine problematische Verallgemeinerung. Dem interaktionistischen Konstruktivismus geht es deshalb im Gegenteil um die Durchdringung von Weltbezügen, wobei das grundsätzliche Konstrukt durch ein bloßes Nach- und Nebeneinander verschiedener pluraler Beobachter, die immer in Beziehungen agieren, damit durch ein stärker relativierendes Konstrukt ersetzt wird. Dabei gibt es durchaus Weltbezüge, aber diese werden in der Durchdringung von Perspektiven und weniger in ihrer bloß rational orientierten Begrenzung gedacht. Diese Abgrenzung will ich näher ausführen. Ich will aber hier nicht weiter den durchaus interessanten Verästelungen der 3-Welten-Theorie nachgehen. Das kommunikative Handeln lässt diese drei Weltbezüge erst als Grenzfälle verständlicher werden (vgl. z.B. Habermas 1988, I, 142 ff.). Ich will nur kurz auf die drei Welten direkt eingehen:
- In den Kränkungsbewegungen hat die objektive Welt für mich eine ausschlaggebende Rolle gespielt. Es ist dies eine engere Beobachtungswirklichkeit, die sich durch den Kontext von Wissen und Wahrheit auszeichnet. Stärker als Habermas betont der interaktionistische Konstruktivismus dabei die re/de/konstruktiven Aktionen der Teilnehmer/Beobachter, wobei die Richtungen der Deutung sich verkomplizieren. Nur in symbolischer Deutung trifft das zu, was Habermas betont: Inwieweit gelingt es dem Akteur, sein Bild von Welt mit der übrigen Welt in Übereinstimmung zu bringen? Inwieweit gelingt es ihm, seine Wünsche und Absichten mit dem, was in der Welt geschieht, in Übereinstimmung zu bringen? Der interaktionistische Konstruktivismus erweitert diese beiden Deutungsrichtungen: Inwieweit gelingt es dem Akteur als gleichzeitigem Teilnehmer und Beobachter in einer Welt (Rekonstruktion von Wirklichkeiten), seine Konstruktionen von Wirklichkeit mit dem in Übereinstimmung zu bringen, was Andere bereits konstruiert haben? (Hierbei zerfallen Verständigungsgemeinschaften in Multikulturalität als Pluralität und Widerspruch von Entwicklungen) Inwieweit konstruiert er hierbei Wünsche und Absichten, die seine Re/De/Konstruktionen antreiben, bereichern, vervielfältigen? Inwieweit motivieren z.B. die imaginären Verschiebungen und Verdichtungen bei solchen Re/Konstruktionen Aspekte der Veränderung, der Dekonstruktion? Inwieweit wirkt neben der symbolischen Ebene das Reale hierbei mit?
Das Imaginäre erscheint zwar bei Habermas, aber nur in rudimentärer Form und allein in der subjektiven Welt. Meine Beschreibung aber lautet anders: Das Imaginäre ist eben immer auch unmittelbarer Teil jener scheinbar objektiven Welt und es subvertiert ständig alle Sachverhalte und re/de/konstruktiven Zuschreibungen. Deshalb gibt es auch nicht nur einen reflexiven Zugang zur objektiven Welt, sondern auch einen vor- oder unbewussten, der vielfältige Möglichkeiten der Deutung eröffnet. Das Imaginäre ist Ausdruck einer veränderten Perspektive, die aber strikt die Notwendigkeit einer interaktiven Anerkennung ausdrückt (Interaktion ist für mich die Bedingung der Möglichkeit menschlicher Imagination). Das Subjektive als interaktives Anerkennen ist mit anderen Worten jeder objektiven Deutung inhärent. Diesen Gedanken werde ich ausführlich in der konstruktivistischen Diskurstheorie weiter unten aufnehmen.
Das Reale hingegen markiert für die objektive Welt eine Grenzbedingung, die die Akteure in ihrer symbolischen und imaginären Reichweite begrenzt. Wirklichkeiten sind zwar Konstruktionen, aber Konstruktionen von Wirklichkeiten sind nicht das Reale schlechthin. Das Reale ist der Mangel an Deutungsmöglichkeit, die jede Reflexion und Argumentation immer schon voraussetzen muss, um nicht selbstgefällig und illusionär (d.h. abschließend oder abgeschlossen) zu sein.
Aus diesen Erweiterungen heraus kann der Sinn der objektiven Welt für einen konstruktivistischen und interaktionistischen Ansatz nicht nur in einer Bezugnahme auf Sachverhalte in allein reflexiver Deutung bestehen. Der Diskurs des Wissens ist subvertiert und als subvertierter darstellungsfähig. Seine Darstellung erweitert die Beobachterperspektiven auch der Wissenschaft, und dies ist im Grunde der Kern dessen, was die Kränkungsbewegungen als nachweisliche Schwäche der wissenschaftlichen Argumentationen, als das Ende der großen Entwürfe und des metaphysischen und universalisierenden Denkens dokumentieren.
- Die soziale Welt ist nach meiner Sicht in die verobjektivierende Wirklichkeitskonstruktion immer schon eingeschlossen. Sie durchquert im Mechanismus von Macht und wechselseitiger Beobachterzurechnung jede Objektivation und subvertiert jeden Sachverhalt. Sachverhalte als reiner Ausdruck von objektiver Welt sind nur aufgrund einer Reduktion des Sozialen aus den Akten der handelnden Wissenschaftler möglich. Radikaler als Habermas sehe ich, dass jede Verständigungsgemeinschaft eine Beziehungswirklichkeit darstellt und als Beziehungswirklichkeit mit allen Unschärfen und Mängeln von Beziehungen immer die vermeintlich objektiven Deutungen subvertiert. Dabei spielen Normen gewiss eine ausgezeichnete Rolle, aber sie sind nur der symbolische Ausdruck eines komplexeren Geflechts von Wirklichkeitsdeutungen. In die soziale Welt gehen symbolische, imaginäre und reale Ereignisse ein, die sowohl subjektive wie objektive Deutungen durch Beobachter erzeugen. Eine Trennschärfe zwischen objektiver und sozialer Welt wird nur erreicht, wenn mittels sozialwissenschaftlicher Kriterien, wie sie Habermas z.B. bereitstellt, die Vielfalt der Bezüge auf bestimmte Deutungsperspektiven verschoben wird.
Hier nun entsteht die Grundfrage, inwieweit eine solche interaktive (soziale) Beziehungswelt nicht immer vor jeglicher objektivierender oder subjektivierender Deutung steht. Nehmen wir den Vorgang der Konstruktion als ein kulturell vermitteltes Ereignis, dann sehen wir recht klar, dass die soziale Beziehungswirklichkeit (im Sinne einer grundsätzlichen Angewiesenheit des Menschen auf Interaktion) gegenüber der Deutung objektiver Sachverhalte und subjektiver Erlebnisse immer einen Hintergrund bildet. Sachverhalte werden dabei notwendig auch aus dem Kontext von Beziehungen heraus gedeutet, wenngleich der Diskurs des Wissens die Aufgabe hat, die Beziehungen zu verschweigen.
In sozialwissenschaftlicher Analyse kann die soziale Welt als normenregulierendes Handeln aufgefasst werden. Aus der Sicht des interaktionistischen Konstruktivismus ist sie zunächst breiter aufzufassen. Die soziale Welt erscheint auch als Beziehungswirklichkeit, in der ein Gemisch aus subjektiven Wünschen (Begehren) vermittelt mit a/Anderen, aus Wissens-, Wahrheits- und Normansprüchen gegeben ist, die in ihrer Vermitteltheit als Re/De/Konstruktionen von Wirklichkeiten ausgeführt werden. Hier konvergieren symbolische und imaginäre Leistungen. Das Reale dient Beobachtern als Grenzbegriff, um die Brüchigkeit des Beobachtungssystems selbst zu markieren.
- Die subjektive Welt umgreift nicht nur Wünsche und Gefühle, sondern ist von vornherein vermittelt über das Begehren interaktiv strukturiert. Habermas erkennt zwar an dieser Stelle Bedürfnisse an, die sich nach Neigungen und Wünschen oder Gefühlen und Stimmungen aufspalten, aber die Situationsbezogenheit erscheint bei ihm als individualisiert, weil die eigentliche Interaktivität in der sozialen Welt stattfindet. Hier erscheint für mich die reduktive Vereinfachung der drei Welten besonders drastisch, denn in der subjektiven Welt wird die Interaktion verharmlost. Subjektivität ist für mich hingegen prinzipiell an ein interaktives Begehren geknüpft, an Spiegelungen in wechselseitiger Anerkennung, die gerade für den Erlebnis- und Gefühlsbereich gelten und auf Objektivierungen und Sozialisierungen übertragen werden. Habermas sieht die Subjektivität nicht als imaginär vermittelte Prozedur, sondern eher vom Resultat her: „Indem wir z.B. einen Gegenstand oder eine Situation als großartig, reich, erhebend, glücklich, gefährlich, abschreckend, entsetzlich usw. charakterisieren, versuchen wir, eine Parteinahme auszudrücken und zugleich in dem Sinne zu rechtfertigen, dass sie durch Appell an allgemeine, jedenfalls in der eigenen Kultur verbreitete Standards der Bewertung plausibel wird. Evaluative Ausdrücke oder Wertstandards haben rechtfertigende Kraft, wenn sie ein Bedürfnis so charakterisieren, dass die Adressaten, im Rahmen einer gemeinsamen kulturellen Überlieferung, unter diesen Interpretationen ihre eigenen Bedürfnisse wiedererkennen können. Das erklärt, warum im dramaturgischen Handeln Stilmerkmale, ästhetischer Ausdruck, überhaupt formale Qualitäten ein so großes Gewicht erhalten.“ (Ebd., 139) Die von Habermas hervorgehobene Rechtfertigung setzt immer schon an der Macht eines faktischen Vollzuges an, genauer an den Ergebnissen („verbreitete Standards der Bewertung“) eines kulturgeschichtlichen Vorgangs. Dies vernachlässigt die widersprüchliche, dekonstruktive Prozedur der Entnormalisierung in den Impulsen des Begehrens und der Subjektivität als Ausdruck einer Suche, eines Ver-Suchens, einer Ver-Suchung. Gefühle und Wünsche sind nicht in erster Linie auf Rechtfertigung aus, wenn sie nicht gerade philosophisch in ein Korsett von rationaler Beanspruchung gepresst werden. Die „objektive Beurteilung“ eines dramaturgischen Handelns von Akteuren bleibt ohnehin Fremdbeobachtern überlassen, die z.B. mittels Reduktionen von Gefühlsambivalenzen, Wunschvielfalt und des unbewussten Begehrens jene Muster identifizieren, die kulturell normativ als vorgängig erscheinen. Dies wird den Subjekten als Selbstbeobachtern der Prozeduren ihrer Subjekt-Findung in singulären Prozessen oft wenig einleuchten: Sie empfinden sich als Subjekte in einer Besonderheit, in einer Individualität, die auf die Spezifik ihres Gefühls abstellt (vgl. nochmals insbesondere Kapitel III.2.2). Nur durch Verobjektivierung einer objektiven Welt gelingt es Habermas, diese Subjektivität zu beruhigen.
Mein Ansatz ist anders. Die beunruhigte Subjektivität streitet immer gegen die Verobjektivierungen. Das Subjekt und seine Beziehungen bilden einen Hintergrund für die Erfordernisse der sogenannten objektiven als auch der sozialen Welt. Damit aber wähle ich eine andere Aufteilung. Sie wird bei mir durch die Unterscheidung der drei in diesem Buch herausgearbeiteten Perspektiven gebildet: Die Beobachtungswirklichkeit als reduzierende Verobjektivierung, die Beziehungswirklichkeit als interaktive Subjektivierung, die Lebenswelt als strukturelle Vermittlung von Beobachtungs- und Beziehungsaspekten. Dabei gelten für alle drei perspektivischen Beobachterbereiche immer symbolische, imaginäre und reale Dimensionen; es wird eine strikte Zirkularität zwischen den Bereichen angenommen; alle Inhalte, die beobachtet werden, berühren immer auch Beziehungen, ebenso wie Beziehungen bestimmte Inhalte zum Ausdruck bringen (vgl. zusammenfassend auch Kapitel V).
Beziehungen und Inhalte (als Ausdruck von Sachverhalten in der Welt) sind in dieser perspektivischen Annäherung insbesondere zwei Beobachtungsfelder, die in ihrer Vermitteltheit die scheinbar eindeutige Wirklichkeit des a/Anderen z.B. in seiner Zurechnung auf objektive, soziale und subjektive Welten subvertieren. Anders gesprochen: Wenn die Inhalte scheinbar klar und eindeutig sind, dann zeigt der Wechsel in die Perspektive der Beziehungen die Auslassungen an, die den unklaren und uneindeutigen Hintergrund erst markieren. Hier erscheint Habermas als wenig hilfreich. Oder umgekehrt: Die scheinbar klaren und eindeutigen Beziehungen werden durch die Wechsel und Ansprüche von Inhalten unterlaufen. Diese Position ist hingegen sehr gut mit Habermas zu studieren.
3.3 Welt- und Produktionsfallen
Die Lebensweltperspektive sichert, dass wir Beziehungen nicht bloß subjektivistisch deuten, sondern in ihrem Zusammenhang als soziale Re/De/Konstruktionen begreifen. Diese Lebenswelt kann allerdings auch sehr schnell zur Falle der subjektiven Mächtigkeit und eigener Konstruktionen werden. Dies will ich exemplarisch an drei ausgewählten Beobachterbereichen diskutieren:
(1) Als Objektfallen erscheinen in der Lebenswelt vorgängige Praktiken, Routinen und Institutionen, die in symbolischer, virtueller und imaginärer Ausprägung beobachtet werden können. Inwieweit können solche Beobachtungen als Verobjektivierung für den Konstruktivismus betrachtet und genutzt werden?
(2) Die Macht ist insbesondere von Foucault – im Anschluss an Nietzsche – als eine universale Kraft rekonstruiert worden, die Verobjektivierungen allesamt subvertiert. Kann diese Bestimmung konstruktivistisch übernommen werden? Oder sollten wir eher Habermas oder dem Anliegen einer postmodernen transversalen Vernunft folgen?
(3) Die Beziehungen sind im Kapitel III ausführlich thematisiert worden. Sie spielen in der Lebenswelt eine wesentliche Rolle. Aber inwieweit gelten sie als Struktur oder nur als singuläre Ereignisse in der Lebenswelt? Ist ihre Komplexität und damit verbundene Unschärfe wissenschaftlich überhaupt tragbar? Welche Lösung bietet der interaktionistische Konstruktivismus für die Beachtung des Wechselspiels – für die Doppelbindung – von Beziehungen und Lebenswelt an?
3.3.1 Objektfallen
Es gibt drei „Deutungsmonster“ mit denen immer wieder eine symbolische Bewältigung und Lösung aller Erkenntnisprobleme im Abendland versucht wird: Wahrheit, Objektivität und Rationalität. Dabei spielen die drei oft perspektivisch zusammen, was Sousa (1997, 239 ff.) an das Spiel Papier, Schere und Stein erinnert, das ich auch in Band 1 in Kapitel II.4 schon angesprochen hatte. Das Papier wird von der Schere geschnitten, die Schere wird vom Stein zerbrochen, der Stein durch das Einwickeln in Papier besiegt. Wer in diesem Kinderspiel im rechten Augenblick den passenden Begriff gegen einen anderen nennt, der gewinnt. Aber ein solches Spiel lässt sich unendlich fortsetzen, und es gibt keinen Sieger auf Dauer. Dies können wir auf die drei „Deutungsmonster“ übertragen:
Die Wahrheit scheint zunächst das privilegierteste Erkenntnisziel zu sein. Sie steht der Objektwelt ebenso nah wie dem Subjekt, soll sie doch eine Übereinstimmung von subjektiv behauptetem Gegenstand oder Sachverhalt und der Welt da draußen herstellen. Sie vermittelt das Eins gegen die Auchs, aber sie kann nie ein eindeutiges Eins gegen alle Auchs für immer geltend machen. Die Wahrheit erweist sich als relativ, weil es Verständigungsgemeinschaften gibt, die zwar nach Wahrheit suchen, aber selbst nie umfassend wahr im Sinne eines Ausschlusses (von Pluralität) sein können. Verständigungsgemeinschaften drängen auf Objektivität, sofern sie ihr gesellschaftliches, kulturelles, wissenschaftliches, soziales Miteinander regeln. Sie benötigen Normen, um zurechnungsfähig auszusagen, was bei ihnen gilt. Dabei tritt die Wahrheit als ein wesentliches Kriterium zur Stützung der objektiven Zurechnung auf. Aber es kann genauso gut die Unwahrheit zugerechnet werden.
Objektivität entsteht nur durch Übereinstimmung der Mitglieder in einer Verständigungsgemeinschaft (ohnehin meist nur durch Mehrheitsbeschluss). Damit ist die Objektivität, in der die Wahrheit ihr Spiel treibt, ein ethnologisch, kulturell, sozial gefangenes, normatives Spiel. In einer Verständigungsgemeinschaft kann es mir so scheinen, als ob ich alles objektiv sehe. Aber hier gilt eine Art Metabeobachtungsposition von Objektivitäten und ich muss eben auch wissen, dass dies andere Ethnien, andere Kulturen oder darin Subkulturen, andere Wissenschaftsschulen, andere soziale Gruppen usw. auch denken, was meinen Anspruch relativiert.
Die Rationalität schließlich scheint eine Art Königsweg zu sein, auf den sich alle Verständigungsgemeinschaften einigen könnten. Gäbe es eine einheitliche und kohärente Rationalität, gäbe es universale Bedingungen gerechter Normen in dieser, dann wären die Wahrheiten und Objektivitäten zumindest unter eine gewisse Kontrolle zu bringen. Könnte also nicht z.B. das Papier auf Dauer der Sieger in unserem Spiel sein? Leider ist die Rationalität aber insbesondere von der Wahrheit abhängig. In ihr findet sie ihr Fundament und vorausgesetzte Erkenntnisse, die andere (überholte) Wahrheiten oder Objektivierungen (anderer Verständigungsgemeinschaften) darstellen. Wenn es z.B. als rational erscheint, dass alle Wahrheiten relativ sind (wie es die erste Kränkungsbewegung zeigt), dann wird dies bereits als eine Wahrheit erkauft. Deshalb wird der Begriff der Rationalität meist sehr doppelzüngig geführt: Einerseits als Anerkenntnis, dass auch Wahrheitsgegner durchaus rational vorgehen, andererseits aber als Unterstellung, dass diese oder jene rational erscheinende Handlung eigentlich völlig irrational ist. Wollte man hingegen eine minimale Rationalität feststellen, die für alles gilt, was noch rational sein soll, dann verfängt man sich in bloßen Allgemeinheiten. So etwa wenn Sousa definiert, dass minimale Rationalität darin besteht, dass unter irgendeiner wahren Beschreibung etwas mit Recht als bewertend rational angesehen werden kann (ebd., 265). Dies lässt der Verständigungsgemeinschaft in der Tat alle – auch die gegensätzlichsten – Optionen der Objektivität und der Wahrheitsbestimmung.
So wie Kinder das Spiel Papier, Schere und Stein ohne Zweck zu spielen scheinen, so werden die Begriffe Wahrheit, Objektivität und Rationalität in unendlichen Sprachspielen in den Wissenschaften immer neu gedeutet. So wurden sie zu Deutungsmonstern.
Eine besondere Falle, in die man bei diesem Spiel mit diesen Deutungsmonstern geraten kann, nenne ich die Objektfallen. Sie entstehen aufgrund der besonderen Mechanismen dieses Wechselspiels, sofern Verständigungsgemeinschaften ihre Objektivität durch eine objektorientierte Wahrheitssuche untermauern und daran die Rationalität anderer Verständigungsgemeinschaften messen. In drei Schritten will ich dies exemplarisch analysieren: (1) im Blick auf Praktiken, Routinen und Institutionen, in denen eine Verobjektivierung durchgeführt wird; (2) im Blick auf die zunehmende Bedeutung des Virtuellen und/oder Imaginären in diesen Prozessen; (3) im Blick auf die Frage, inwieweit eine objektorientierte Produktion als Basis für alle weiteren Konstruktionen gelten soll (Abgrenzung zu Marx).
3.3.1 Praktiken, Routinen und Institutionen
Die Modernisierung (vgl. Beck u.a. 1996), eine Perspektive, unter der sich die Moderne in ihren vermeintlich fortschrittlichen, zivilisatorischen und entwicklungsbezogenen Leistungen gerne ausdrückt (vgl. einführend Loo/Reijen 1992), bringt einen Objektivismus hervor, der besonders Eingang in die Praktiken, Routinen und Institutionen (des Alltags und der Wissenschaften) findet. Die Objektivierungen als sprachliche Praxis habe ich bereits ausführlich in Kapitel III.2.2 angesprochen. Dort zeigten sich kognitive Sprachstrategien und alltägliche Sprachpraxen als Ausdruck einer kommunikativen Beziehungswelt, in die normative und soziale Ansprüche kontextbezogen eingehen. In der Diskussion der Beziehungswirklichkeit erweiterte ich dann allerdings den kognitiven Bezug und schloss auch Gefühle und interaktive Wechselbeziehungen in imaginärer Hinsicht mit ein. Solche Sprachpraxen setzen wir stets voraus, wenn wir von dem handeln, was jetzt in den Vordergrund der Betrachtung gerückt wird: soziale Praktiken, Routinen und Institutionen.
So wie die Moderne sich durch harte Fakten, Objektivationen in materiellen Gestalten, ungeheure Warenmassen und mit diesen verbundene Märkte, zugleich aber auch in kodifizierten Gesetzen und Institutionen, die sich zu Bürokratien ausweiten, dokumentiert, so disziplinieren sich die Wissenschaften, indem sie eine symbolische Ordnung errichten, die vor allem dem Zweck dient, die gewonnene Sicht und Modernität der eigenen Auffassungen zu sichern und gegen Einbrüche von außen abzugrenzen. Gleichwohl produziert dies einen notwendigen Gegenangriff, der oft als Subjektivismus charakterisiert wird, und der auf die Defizite der objektivistischen Modelle hinweist: Mangelnde Alltags- und Beziehungsnähe, Abkopplung von den Lebensformen und der Praxis, Dogmatisierung bestimmter Sichtweisen und unzulässige Universalisierung.
Für beide Sichtweisen erscheint die Moderne als eine Falle: Einerseits ist sie die Bedingung der Möglichkeit wissenschaftlichen Fortschritts und Fortschreitens in einer hinreichend sicher geglaubten objektiven Welt, was überhaupt erst den Anspruch von Wissenschaften auf Wahrheit und Voraussicht legitimiert – hier sitzt der Wissenschaftler also in der Falle einer Abhängigkeit, die er möglichst unabhängig und eigenständig objektiv zu beschreiben versuchen will; andererseits eröffnet die Moderne Freiheitsräume, die nunmehr gegen sie als subjektive Beanspruchung auf je eigene konstruierte Wahrheit von Subjekten bzw. Gruppen von Subjekten eingeklagt werden – hier sehen sich die Wissenschaftler in den Fallen der Moderne, denen sie zu entkommen versuchen.
Pierre Bourdieu ist in Bezug auf beide Sichtweisen ein Theoretiker und empirisch orientierter Analytiker, der den Widersprüchen der Fallen entkommen will, indem er sich auf die Praxis zurückbezieht. Sein Modell erscheint mir paradigmatisch für ein Begründungsproblem jeder konstruktivistischen Sichtweise, die sich in einer Zeit, mit einer Zeit und ihren rekonstruktiven Kontexten, oft auch gegen sie zu stellen hat. Geht solche dekonstruktive Arbeit überhaupt? Hat sie ihre Grenzen? Ihre notwendigen Verkennungen? Dies sind Fragen, mit denen sich Bourdieu intensiv auseinandersetzt.
Wenn man mittels einer Beobachtertheorie Praktiken des gesellschaftlichen, sozialen Lebens analysiert, dann steht man entweder in der Gefahr, sich große Theorien auszubilden, in denen die Makrobewegungen verallgemeinert rekonstruiert werden, die eine damit stark vereinfachte Lebenswelt darstellen, oder sich im Detail der Lebenswelt selbst zu verlieren. Im ersten Fall verschwinden die einzelnen Praktiken hinter der Theorie, im zweiten zerfällt alles in Unübersichtlichkeit. Bourdieu versucht, beide Fehler zu umgehen, indem er eine Theorie der Praxis vorschlägt, die sowohl Fehler eines Objektivismus als auch eines übertriebenen Subjektivismus vermeidet (vgl. dazu einführend z.B. Bourdieu/Wacquant 1996, 24 ff.). Er erkennt dabei grundlegend an, dass die Sichtweisen und Interpretationen der Akteure in ihren Praktiken der Lebenwelt ein notwendiger Bestandteil einer objektivierenden Sicht auf diese sind. Für ihn steht die Wissenschaft in einer doppelten Aufgabe: Einerseits objektive Strukturen der Gesellschaft anzuerkennen, andererseits aber zu beachten, dass die Akteure stets unscharfen, subjektiven Sinn in diese Objektivität einbringen. Bourdieu, der seinen Ansatz auch als strukturalistischen Konstruktivismus bezeichnet (vgl. ebd., 29), schwankt allerdings zwischen einer Objektivierung, in der er bloß eine „Ordnung der Dinge“ abgebildet sieht, und der Feststellung, dass die soziale Wirklichkeit von kompetenten sozialen Akteuren hervorgebracht wird, ohne dass eine universelle Ordnung zugrunde liegt. So sagt er: „Von allen Formen der „unterschwelligen Beeinflussung“ ist die unerbittlichste die, die ganz einfach von der Ordnung der Dinge ausgeübt wird.“ (Ebd., 205) Hier erkennt Bourdieu zwar einerseits den Ansatz der Ethnomethodologen an, die in den Kompetenzen der sozialen Akteure eine Konstruktion der Welt durch organisierte Alltagspraxen sehen, aber er grenzt sich gegen die Kontingenz und Willkür der Deutungen durch zwei Ansprüche auch deutlich ab (ebd., 27 f.): Erstens will er nicht nur eine Beschreibung von Praktiken, sondern auch eine Beschreibung von objektiven Strukturen erreichen, die solche Praktiken überhaupt ermöglichen und zirkulär mit den Akteuren verbinden, d.h. er will vor allem das Fortbestehen solch objektiver Praxen verstehen; andererseits will er die objektiven Voraussetzungen klären, die die Akteure durch die Aufnahme schon vorhandener Konstruktionen reproduzieren. In übertriebener Weise fordert er – hier noch ganz von Mauss beeinflusst – zu einer totalen Wissenschaft auf, die letztlich den eigenen Konstruktivismus dadurch verabsolutiert, dass er immer wieder illusionär meint, eine totale (empirisch gestützte) Erfassung von Positionen zu erreichen und sich sicher zu sein, dabei eine objektive materielle Basis identifizieren zu können. Totale soziale Tatbestände sind für Mauss Ereignisse, die gesellschaftliche Institutionen oder eine Gesellschaft insgesamt in ökonomischer, rechtlicher, religiöser usw. Natur in Bewegung setzen. Bourdieu will mit seinem Anspruch zwar einerseits nur eine unnötige Spezialisierung vermeiden, andererseits überfordert er seinen Ansatz mit einem uneinlösbaren Anspruch auf Vollständigkeit, für die er kein plausibles Beobachtermodell zur Verfügung stellen kann (vgl. ebd., 49 f.). Diese Position ist aus meiner Sicht nicht haltbar und untergräbt das konstruktivistische Anliegen. Dies geht mit dem Fehlen einer Beobachtertheorie einher, was Bourdieu immer wieder erschwert, seine eigene Position im Wechsel von der Fremd- zur Selbstbeobachterseite wie auch umgekehrt zu erkennen und zu legitimieren. Deshalb will ich Bourdieu nachfolgend umdeuten und auf das Primat der Perspektivität, wie es der interaktionistische Konstruktivismus begründet, beziehen. Dazu gehört eine strikte Ablehnung und Kritik einer Objektivitätsauffassung, die ihre eigene gewählte konstruktivistische Grundlage unterläuft. Insbesondere versuche ich die Sichtweise Bourdieus dort zu erweitern, wo er
- die Rolle des individuellen Beobachters zu sehr verleugnet und zu ausschließlich auf die verallgemeinerten Beobachtungen des Wissenschaftssystems abhebt (ebd., 70); Bourdieu entgehen deshalb die Pointen der verschiedenen Positionen von Selbst- und Fremdbeobachtern häufig; allerdings besteht seine Stärke auch darin, für größere Gruppen typische Verhaltensweisen so gut erfassen zu können;
- den Wahrheitsbegriff noch traditionell benutzt; er vollzieht nicht konsequent genug eine konstruktivistische Analyse des Wahrheitsbegriffs, sondern steht noch teilweise im Gedanken der Aufklärung, wenngleich er transhistorische und universelle Ansprüche vehement ablehnt (ebd., 77 f.); insbesondere fehlt bei Bourdieu eine hinreichende kritische Auseinandersetzung mit Foucault an dieser Stelle. Allerdings meint Bourdieu, wie wir gleich noch sehen werden, diese mit seiner Theorie des Feldes und des Habitus geleistet zu haben. Hier überschätzt er, so denke ich, sein Modell;
- aufgrund seiner objektivistischen Vorannahmen den Dekonstruktivismus poststrukturalistischer Autoren problematisch deutet: „Würde sich die Dekonstruktion selber dekonstruieren, müsste sie die historischen Bedingungen ihrer Möglichkeit entdecken und damit zugeben, dass auch sie Kriterien für Wahrheit und rationalen Dialog voraussetzt, deren Wurzeln in der sozialen Struktur des intellektuellen Universums liegen.“ (Ebd., 79) Diese Deutung steht im stillen Einverständnis eines nicht-konstruktivistischen Wahrheitsbegriffs, der den Akt der Dekonstruktion überfordert: Diese kann zwar Kriterien für Wahrheit und rationalen Dialog angeben, aber immer nur in Anerkennung einer Konstruktion von Wirklichkeit, die die Objektivität an die sozialen Akteure und deren Verständigungsgemeinschaften zurückbindet. Bourdieu aber will mehr: Er will diese Rückbindung mittels einer möglichst totalen Sicht verobjektivieren, ohne dabei das Primat der Perspektivität – als notwendige Ausschlussbedingung aus jeder Totalität – hinreichend anerkennen zu wollen; so erliegt er doch wieder dem Objektivismus an zahlreichen Stellen seines Werkes; auch wenn Bourdieu dabei keinen reinen Determinismus intendiert, so wird er aus diesem Grund doch häufig als deterministisch argumentierender Autor kritisiert:
- symbolische Analysen in seinem Werk dominieren lässt und nicht hinreichend Interaktionen und imaginäre Vorstellungen und Vermittlungen thematisiert. Insgesamt kommt eine Analyse der Beziehungswirklichkeit zu kurz, was sich insbesondere auch darin dokumentiert, dass Bourdieu zwar vielfältige soziale Praktiken untersucht hat, aber den Familien und konkreten interaktiven Kommunikationssituationen insgesamt wenig Aufmerksamkeit schenkt. Dies scheint mir nicht so forschungszufällig zu sein, wie er es selbst darstellt (vgl. Bourdieu in Liebau/Müller-Rolli 1985, 376 f.).
Trotz dieser Einwände erweist sich eine Stärke der Arbeiten Bourdieus nun darin, dass sie durch ihr Drängen auf Verobjektivierung uns Beobachterkategorien hervorhebt, die durchaus geeignet sind, gerade die Felder gesellschaftlicher Praktiken, Routinen und Institutionen zu analysieren und Übergänge zwischen diesen drei Bereichen zu rekonstruieren. Deshalb will ich diese Theorie hier kurz darstellen und für mein konstruktivistisches Anliegen teilweise umdeuten.
In einem Schaubild will ich Grundlagen des Ansatzes von Bourdieu einführend darstellen (vgl. zum folgenden auch Reich/Wei 1997, 15 ff.):
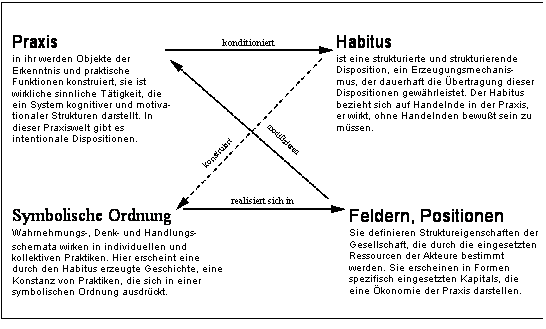 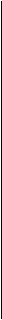
Abbildung: Beobachterkategorien nach Bourdieu
Grundsätzlich müssen wir nach Bourdieu die in wirklicher, sinnlicher Tätigkeit vorherrschenden Praktiken zum Ausgangspunkt jeder Betrachtung sozialer Verhältnisse und sozialen Sinns nehmen. Dieser Ausgangspunkt konditioniert als Klasse von Existenzbedingungen bestimmte Habitusformen, die als Systeme dauerhafter und übertragbarer Dispositionen angesehen werden. Die sozialen Gebrauchsweisen, das ist sein zentrales Anliegen, definieren dabei alle objektiven Möglichkeiten eines lebensweltlichen Umgangs. Darin erscheint ein Objektivismus, den Bourdieu andererseits kritisiert. Er will nicht eine objektivistische Gesellschaftstheorie entwickeln, aber er rekurriert doch stark auf das Vernunftmodell der Aufklärung und vernachlässigt insbesondere die innere subjektive Spannung, die ich bei Mead hervorgehoben habe („I“ und „Me“), das interaktive Verhältnis zwischen Subjekt und Anderen (das er in allgemeineren Strukturen aufgehoben sieht), den Blick auf das Imaginäre (das er meist symbolisch überdeckt) und das Reale (das er auf Praxis und Praktiken reduziert). Immerhin unterscheidet ihn von objektivistischen Theorien ein relativierter Wahrheitsanspruch (vgl. Liebau 1987, 52 ff.). Ich will nun das Modell, das ich über Bourdieu gebildet habe, etwas näher interpretieren:
(1) Die Praxis soll Ausgangspunkt aller Überlegungen sein. Aber was ist Praxis? Sie zerfällt in sehr unterschiedliche Praktiken. Wie Marx in seinen Feuerbach-Thesen will Bourdieu die sinnlich wirkliche, die tätige Seite in der Praxis in den Vordergrund aller Beobachtungen rücken (vgl. Bourdieu 1993, 97 ff.). Eine Theorie über die Praxis verstellt immer auch die eigentlichen Bedingungen der Praxis. Dies liegt nach Bourdieu schon an einer zeitlichen Verschiebung: Die Praxis ist im Hier und Jetzt, die Theorie hebt die Zeit im symbolischen System auf (ebd., 149). Hier aber fallen wir leicht einem Zirkelschluss zum Opfer, denn auch Bourdieu als Soziologe und Ethnologe, der verschiedene Praktiken beschreibt, kann dies nur als Beobachter und theoretisch tun, wobei sein Zurück zur Praxis schnell zur Falle eines verdeckten Objektivismus wird. Zwar lehnt Bourdieu den „Zettelkasten vorgefertigter Meinungen“ ab, aber diese Relativierung der eigenen beobachtenden Sicht erlöst auch ihn nicht von bestimmten Erkenntnisinteressen eines Beobachters. Die methodologische Reflexion dieser Beobachtungsleistung aber ist nun leider ein Defizit seines Modells, das seine Stärke vor allem daraus ziehen kann, dass es uns als Kreislauf durch die Positionen Praxis, Habitus, symbolische Schemata und Felder der Beobachtung strukturelle Fragen abverlangt, die eine ausschließlich interaktionistisch orientierte Modellsicht uns bisher noch nicht eröffnet hat.
Es ist ein Problem, dass wir immer erst im Nachhinein spezifizieren können, was diese Praxis eigentlich ist, obwohl diese Praxis nach Bourdieu genau den Habitus konditioniert und determiniert, der seinerseits zum entscheidenden Erzeugungsmechanismus in einem gesellschaftlichen System wird. Bourdieu fürchtet eine zu große Singularität, Kontingenz und Individualität, die das wissenschaftliche Bemühen unterlaufen, möglichst exakte Analysen von Praxis vorzunehmen. „Gewillt, Herr und Meister seiner selbst und seiner Wahrheit zu bleiben, keinen anderen Determinismus als den seiner eigenen Entschlüsse anzuerkennen (auch wenn er diesen den Charakter der Unbewusstheit zugesteht), muss für den in jedem Menschen steckenden naiven Humanisten jeder Versuch zur ‚soziologischen‛ oder ‚materialistischen‛ Reduktion werden, der nachweisen will, dass der Sinn noch der persönlichsten und ‚transparentesten‛ Handlungen nicht dem Subjekt zuschreibbar ist, das sie ausführt, sondern sich aus dem umfassenden System der Beziehungen ergibt, in dem und durch das diese Handlungen geschehen.“ (Bourdieu u.a. 1991, 20) Bourdieus Anspruch wendet sich einerseits folgerichtig gegen zu großen Subjektivismus, der soziale Umstände vergessen macht und damit lebensfremd wird. Sie ist aber andererseits dann übertrieben, wenn Bourdieu unterstellt, als könnte ein wissenschaftlicher Beobachter das System der Beziehungen hinreichend durchschauen. Bourdieu, das fällt auf, stellt sich weniger den Unschärfen der Beziehungswirklichkeit, sondern reduziert diese auf bestimmte soziale Praktiken, die er vorrangig analysiert. Zwar will er diese Praktiken nicht aus partikularen Funktionen ableiten, er will sich auch vor vorschnellen Universalisierungen hüten, aber er muss sich gleichwohl auf die Auswahl bestimmter Praktiken begrenzen. Im Gegensatz zu meiner Beobachtertheorie verfügt Bourdieu an dieser Stelle aber über kein Modell, das seine eigene Begrenztheit ausweist oder dekonstruieren hilft. Als Konstruktivist sehe ich die Praxis offener als Bourdieu, und ich entschärfe damit sein methodologisches Dilemma, vergrößere aber die Unschärfe der Erkenntnis. Dies ist durch den Einbezug der sehr unscharfen Beziehungswirklichkeit in jede Lebensweltanalyse zwangsläufig. Praxis ist ein Beobachterkonstrukt, das näher als Theorien am Ort des Geschehens von Handlungen situiert sein soll. Aber es ist ein Konstrukt, das oft bloß eine theoretische Attitüde ausspricht. Wie z.B. sollen wir die Praxis einer bestimmten Verständigungsgemeinschaft wiedergeben, wenn wir großenteils auf theoretische Quellen angewiesen sind? Vermögen archäologische Rekonstruktionen, Funde einzelner Objekte, Berichte in Quellen, Aussagen von uns fremden Augenzeugen usw. wirklich den theoretischen Kontext praktisch zu hinterfragen oder bilden sie nicht eher seine Illustration? Oder nehmen wir uns als teilnehmende Beobachter einer bestimmten Praxis. Sind wir damit hinreichend kompetent, diese Praxis umfassend zu beurteilen? Sind wir in der Lage – und inwieweit sind wir in der Lage? –, uns in Positionen von Akteuren hineinzuversetzen? Als Konstruktivist muss ich jede Form einer Abbildung von Praxis in Theorien, einer scheinbar klaren Widerspiegelung ablehnen. Mit Bourdieu kann ich allerdings zugeben, dass die Beobachter einer Praxis graduell näher oder ferner stehen.
Bourdieu will nun die Logik der Praxis näher erfassen. Aber auch er muss zugestehen, dass die Logik der Praxis, die ja schon einen Beobachter, der die Logik vertritt, voraussetzt, eine zwiespältige Angelegenheit ist: Sie changiert zwischen behaupteter Einheitlichkeit und einer postulierten Gesetzmäßigkeit bis hin zu einer Verschwommenheit und dem Bemerken von Unregelmäßigkeiten. Bourdieu will im Zurück zur Praxis jene innere Logik von Bedingungen wiederherstellen, die die jeweilige Praxis ausgezeichnet hat (Bourdieu 1993, 166 ff.). Aber damit verstrickt er sich und uns in eine Selbstwidersprüchlichkeit: Einerseits sollen wir zurück zu einer Praxis, der „man ihre praktische Notwendigkeit zurückerstatten muss“ (ebd., S. 178), andererseits können wir dies aber nur als theoretische Beobachter, da wir ja selbst in einer momentanen Praxis als Autoren eines symbolischen Systems schon ausschließend gegenüber dem Ereignis selbst wirken. Hier ist also stets in der Reflexion der eigenen Beobachtungen zu hinterfragen, was Objektivität einer Praxis ist.
Die Objektivität sieht Bourdieu in eine erste und zweite Ordnung zerfallen. Die erste Ordnung wird durch die Distribution von materiellen Ressourcen und die Aneignung von gesellschaftlichen Gütern und Werten (Kapitalsorten, wie Bourdieu sagt) gebildet. Die zweite Ordnung ist eine symbolische Matrix des praktischen Handelns, in der Verhaltensweisen, Gedanken, Gefühle und Urteile sozialer Akteure nach bestimmten Routinen und in bestimmten Institutionen geregelt werden (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996, 24 ff.). In der ersten Sichtweise scheint die Gesellschaft in objektive Strukturen zu zerfallen, die von außen betrachtet werden können. Man beobachtet nur die Manifestationen von tatsächlichen, materiellen und strukturellen Vorgängen. Aber hier ist zu beachten, dass der Wissenschaftler stets ein Strukturmodell zur Beobachtung anlegt, das nicht direkt mit der Realität, die er beschreibt, identifiziert werden kann. Deshalb ist die zweite Ordnung zugleich untrennbar mit der ersten verbunden. Die sozialen Akteure sind subjektive und konstruktive Beteiligte am Prozess der Herstellung von Objektivität. Aber dies bedeutet für Bourdieu nun keinesfalls, die Praxis zu subjektivieren. Sein Anspruch besteht darin, die Hintergründigkeit der subjektiven Konstruktionen als objektive ins Spiel zu bringen. Angeregt von Marx will er in einer „totalen“ Analyse solche objektiven Strukturen bloßlegen, um der Wahrheit sozialer Prozesse auf die Spur zu kommen. Für ihn ist die Frage entscheidend, was hinter dem Rücken der sozialen Akteure als Vorbedingung ihres Agierens liegt, um hierüber aufzuklären. So entwickelt er ein Konzept der teilnehmenden Objektivierung (ebd., 287 ff.), das in dem Bemühen steht, eine soziologische Objektivierung sowohl des Objekts der Untersuchung als auch des Verhältnisses des Subjekts zu seinem Objekt in der Praxis zu demonstrieren. Leider fehlt jedoch Bourdieu hier eine Beobachtertheorie, die das komplexe Verhältnis von objektivierenden und subjektivierenden Perspektiven klarer reflektieren lässt. Bei Bourdieu scheint es vielfach so, als siegten auf Dauer doch immer wieder die objektiven Verhältnisse, weil sie jedem subjektiven Beobachter als Voraussetzung nachweisbar sind. Aber dieser Nachweis – und hier ist Bourdieu oft weniger kritisch – ist der des Beobachters Bourdieu, dessen bestimmte Interessen in den Vorgang schon eingegangen sind, aber ein blinder Fleck in der Verobjektivierung, d.h. der Feststellung des eigentlich Objektiven bleiben.
Insoweit relativiert der interaktionistische Konstruktivismus den Determinismus, der bei Bourdieu zu finden ist. Ich schlage vor, den Praxisbegriff weiter als Bourdieu zu verwenden, wobei alle Praktiken aus der Sicht eines Spannungsverhältnisses zwischen Beobachter und Beobachtung – und dabei zwischen imaginären, symbolischen und realen Perspektiveinnahmen – einzubeziehen wären. Wesentlich für lebensweltliche Theorien ist die symbolische Praxis, die sich im Denken und dessen Quellen und Bezügen herstellt. Die imaginäre Praxis ist ungleich schwieriger zu erfassen, weil sie uns als Beobachter noch mehr als im Symbolischen darüber spekulieren lässt, welchen Antrieben die Konstruktion solcher Lebenswelten selbst unterlegen gewesen sein mag. Die reale Praxis aber ist bloß ein Grenzbegriff, der zwar auf das hinweist, was auch Bourdieu intendiert (diese eine wirkliche Praxis, die reale Praxis), die jedoch nur als Leerstelle, als Bruch in unseren symbolischen und imaginären Ordnungen bemerkt werden wird. Um es für die Analyse der Lebenswelt zu verdeutlichen: Wir können über verschiedene Ansätze mit ihren symbolischen Systemen sprechen, Hypothesen zur imaginären Seite dieser Theorien bilden, aber doch je die realen Wirkungen dieser Theorien im Blick auf die Praxis in ihrer Zeit verfehlen. Woran liegt dies? Es liegt an der Verständigung über diese Praxis selbst, die von unterschiedlichen objektivierenden Verständigungsgemeinschaften je nach Interessen- und Machtlage unterschiedlich gedeutet sein wird. Die Art dieser Verfehlung müssen diese Verständigungsgemeinschaften jedoch verschweigen – sie bleibt bloß abstrakt genannt –, da das Reale von ihnen bereits symbolisch gereinigt wurde und nur vermittelt über das Symbolische noch vorkommen kann. Es gibt sie nicht, diese ewige Praxis. Aber dennoch erscheint das Reale in unseren Lücken, weil wir in der Konkurrenz von Beobachtern bemerken, dass etwas fehlt, was wir als eine unbegreifliche, noch nicht begriffene Erscheinung in der Realität ansehen. Würden wir dieses Ansehen aufgeben, so müssten wir unsere Ansichten dogmatisieren und kämen über kurz oder lang zu einer illusionären Behauptung: Es gäbe sie doch, diese ewig sich gleichbleibende Praxis oder Realität.
Bourdieu meint, dass wir – aufgrund der Tatsache, dass wir in eine soziale Welt hineingeboren werden – dieser Welt wie selbstverständlich ausgesetzt seien. Nochmals: „Von allen Formen der „unterschwelligen Beeinflussung“ ist die unerbittlichste die, die ganz einfach von der Ordnung der Dinge ausgeübt wird.“ (Ebd., 205) Aber dies scheint nur ein halbierter Konstruktivismus zu sein. Für mich wird auch die Ordnung der Blicke entscheidend: Die Lernprozesse, sich des gegebenen Standes einer Ordnung der Dinge zu vergewissern, sind keineswegs so selbstverständlich oder leicht, wie es Bourdieu ansieht. Sie unterliegen einem ständigen Druck der Entscheidung für bestimmte Perspektiven, die erst subjektiv hergestellt und keineswegs objektivistisch unterschwellig immer schon unterstellt werden können. Deshalb lehnt der interaktionistische Konstruktivismus auch das monistische Erkenntniskonzept Bourdieus ab, das Unterscheidungen wie subjektiv und objektiv, bewusst und unbewusst, innen und außen usw. verwirft (vgl. ebd., 40 ff.), um die Beobachtung objektiver Strukturen und Funktionen so in reinerer Form erscheinen zu lassen. Für Bourdieu sind die Spielzüge der sozialen Ordnung immer schon gemacht, bevor die Subjekte spielen. So wird der individuelle Beobachter unterschätzt (ebd., 70), obgleich Bourdieu selbst ein solcher Beobachter ist. Hierbei unterschätzt Bourdieu insbesondere subjektive, unbewusste und kreative Potenziale des individuellen Beobachters. Er bevorzugt die Perspektive einer sozialen Objektivierung, ohne plausibel darlegen zu können, von welcher unabhängigen Art hier seine interessen- und machtbezogene Beobachtung eigentlich sein soll. So scheint Bourdieu im Gegensatz zu meinem Anliegen den Beobachter als einen Beobachter überzubetonen. So heißt es vereinseitigend z.B.: „Was in der sozialen Welt existiert, sind Relationen – nicht Interaktionen oder intersubjektive Beziehungen zwischen Akteuren, sondern objektive Relationen, die ‚unabhängig vom Bewusstsein und Willen der Individuen bestehen‛, wie Marx gesagt hat.“ (Ebd., 127) Aber diese Unabhängigkeitsthese verengt die Perspektive von Bourdieu. In seiner Perspektive werden sozial verkettete Akte und Operationen – auch kollektiv unbewusster Natur – als Hintergrund aller subjektiven Handlungen angenommen, um so das Privileg des erkennenden Subjekts zu brechen. So entsteht eine eigentümliche Bewegung des Denkens (vgl. ebd., 248 f.): Das je empirische Subjekt soll in seiner Zuordnung zu einem bestimmten Ort des sozialen Zeit-Raumes erklärt werden. Was aber kann zu dieser Erklärung benutzt werden? Dies sind die Begriffe und Theorien der von wissenschaftlichen Subjekten bereits erklärten, konstruierten Objektivität. Diese Objektivität, die als soziale Praxis hinter dem Rücken der Subjekte wirkt und alle ihre Interessen, Triebe, gedanklichen Äußerungen usw. beherrscht, ist nun aber Voraussetzung auch von wissenschaftlichen Subjekten, die eine solche Objektivität als strukturierendes Konstrukt entwerfen. Sie entwerfen damit die Voraussetzungen der Bedingungen der Möglichkeit von Subjekten, wobei sie – und dies ist die Pointe – selbst als in einem solchen Entwurf stehend sich zeigen. Die Konsequenz scheint folgende zu sein: „Die Bedingungen der Möglichkeit des wissenschaftlichen ‚Subjekts‛ und die seines Objekts sind ein- und dieselben, und jedem Fortschritt in der Erkenntnis der sozialen Produktionsverhältnisse der wissenschaftlichen ‚Subjekte‛ entspricht ein Fortschritt in der Erkenntnis des wissenschaftlichen Objekts, und umgekehrt. Das wird nirgends so deutlich wie da, wo die Forschung das wissenschaftliche Feld selber, also das eigentliche Subjekt der wissenschaftlichen Erkenntnis, zu ihrem Objekt macht.“ (Ebd., 249)
Aus interaktionistisch-konstruktivistischer Sicht wird hier ein entscheidender Konstruktionsfehler gemacht. Bourdieu lässt die Vielfalt der möglichen Beobachter nach einem Mechanismus der universellen Aufklärung in ein hypothetisches Subjekt (den Wissenschaftler) zurückfallen. Nur so kann er eine Objektivität seines Gegenstandes zurückgewinnen. Aber genau dies ist die Illusion seines Verfahrens, denn so wird aus den vielen Beobachtern nur noch die eine Beobachtung, die uns der Beobachter Bourdieu liefert. Dieser Selbstwiderspruch wäre Bourdieu deutlicher, wenn er entweder eine Beobachtertheorie umfassender entwickelt hätte oder das objektivierende Ziel der Aufklärung als eine vereinheitlichende Bewegung deutlicher aufgeben könnte. Der erste Punkt entgeht ihm, weil er den Konstruktivismus eher noch als Strukturalismus betreibt. Der zweite, weil er zum Dekonstruktivismus eine recht pauschal abwehrende Stellung einnimmt.
Warum aber rekurriere ich bei diesen Bedenken auf Bourdieu? Er bietet (in der zu kritisierenden Beschränktheit seines Modells) Beobachterkategorien an, die sehr gut auf unterschiedliche Lebensverhältnisse passen. Er bildet gerade gegenüber naiv subjektorientierten Theorien einen guten Gegensatz, indem er vorgängige Praktiken, Routinen und Institutionen der sozialen Welt aufzeigt, wie sie sich heute einem kritischen Beobachter stellen können. Nehmen wir sie also als ein soziales Konstrukt von Lebenswelt, das zwar nicht eine totale Analyse erbringen kann, dessen Objektivität durch die Verständigungsgemeinschaft, die sie für eine begrenzte Zeit akzeptieren will, begrenzt wird, dann kann uns diese Analyse helfen, einen rekonstruktiven Rahmen von Lebenswelt auch für den Konstruktivismus zu präzisieren.
(2) Die Idee vom Habitus begegnet uns sehr konkret in den Praktiken und Routinen unserer Lebenswelt. Was ist der Habitus?
Der Habitus ist eine Art Strukturmodell, das eine Funktion beschreibt. Etwas kommt im Verhalten von Menschen vor, und der Habitus gibt an, weshalb es so und nur so vorkommt. Er ist ein Erzeugungsmechanismus von Strategien, die es in der Lebenswelt ermöglichen, unvorhergesehenen und neuartigen Situationen zu begegnen. In ihm verflechten sich Ansprüche, Erwartungen und Gewohnheiten. „Da er ein erworbenes System von Erzeugungsschemata ist, können mit dem Habitus alle Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen, und nur diese, frei hervorgebracht werden, die innerhalb der Grenzen der besonderen Bedingungen seiner eigenen Hervorbringung liegen.“ (Bourdieu 1993, 102)
Der Habitus ist dabei von der Struktur, die ihn bestimmt, d.h. der Praxis, abhängig. Insoweit, dies will ich auch gegen Bourdieu festhalten, ist der Habitus bloß eine Beobachterkategorie, mit der wir einige Züge lebensweltlichen Verhaltens konstruktiv festhalten, die aber nicht alle Gedanken, Wahrnehmungen und Handlungen solcher Lebenswelt umfassen werden, sondern nur von uns in den Strukturen erkannte und gemeinte Strategien bezeichnen helfen. Was erzeugt ein solcher Habitus?
„Der Habitus ist eine Instanz zur Vermittlung von Rationalität, aber eben von einer praktischen Rationalität, die einem historischen System von sozialen Verhältnissen immanent ist und damit dem Individuum transzendent. Die von ihm ‚gemanagten‛ Strategien sind systematischer Natur und doch insofern Ad-hoc-Produkte, als ihr ‚Auslöser‛ immer erst das Zusammentreffen mit einem bestimmten Feld ist. Der Habitus ist schöpferisch und erfinderisch, aber in den Grenzen seiner Strukturen.“ (Bourdieu/Wacquant 1996, 39 f.)
Seine Strukturen verweisen offensichtlich auf kognitive und emotionale Schemata, aber diese werden von Bourdieu nicht differenziert dargelegt. Der Habitus ist unscharf und verschwommen (ebd., 44). Bourdieu/Wacquant (ebd., 45) verweisen bei der Unschärfe des Begriffs auf Wittgenstein (1984, 329): „Wenn ein Begriff von einem Lebensmuster abhängig ist, so muss in ihm eine Unbestimmtheit liegen.“ Hier hätte Bourdieu auch an John Dewey und sein ähnliches Konzept von habits anschließen können. Aus dieser Sicht wird vor allem die Rolle der Erziehung noch deutlicher als es bei Bourdieu erscheint. Für ihn zeigt der Habitus vielmehr vorrangig Konditionierungen einer gesellschaftlichen Praxis an. Die konditionierten Erfahrungen in der sozialen Praxis werden dabei über Kategorien wahrgenommen, die bereits in früheren Erfahrungen konstruiert wurden. Sie müssen den Handelnden selbst gar nicht mehr bewusst sein, sondern können automatisch – aus Gewohnheit – ausgeführt werden. Hier ergibt sich eine Bevorzugung früherer Erfahrungen und als Kategoriensystem ein relativ geschlossener Habitus (Bourdieu/Wacquant 1996, 168). Der Akteur weiß sich nach seinem Habitus situativ so zu verhalten, dass die subjektiven Erwartungen und objektiven Chancen aneinander angepasst werden (ebd., 163 f.); er ist daher für soziale Routinen unentbehrlich.
(3) Der Habitus erzeugt explizite und implizite Schemata, die als Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata individuelle wie kollektive Praktiken leiten. Bourdieu spricht auch von Lebensstilen, die so erzeugt werden. Sie haben nicht die Schlüssigkeit eines abgestimmten kausalen Plans, sie sind nicht vollständig vorhersagbar, als Praktiken folgen sie aber Regeln und Normen, die als Teil der Lebenspraxis und nur in dieser Praxis selbstverständlich sind. Bei der Verwaltung dieser Schemata kommt dem Bildungssystem eine bevorrechtigte Stellung zu. Aber diese Schemata sind damit keineswegs bloß Konstrukte einer in der sozialen Praxis als Teilsegment abgekapselten Bildung. Sie sind vielmehr ständiger Ausdruck dieser Praxis selbst, sie sind Ausdruck sozialer Aufteilungen ebenso wie politischer Ansprüche (vgl. ebd., 31 ff.). Dabei kommt auch der wissenschaftlichen Beschreibung dann eine Aufgabe zu: „Indem sie das, was die Praktiken von innen steuert, außerhalb, in der Objektivität, in Form beherrschbarer Grundsätze erzeugt, ermöglicht die wissenschaftliche Analyse eine echte Bewusstwerdung, eine (im Schema verdinglichte) Umsetzung des Schemas in die Vorstellung, mit der man die praktischen Grundsätze symbolisch meistern kann, die der praktische Sinn ausagiert, ohne sich eine Vorstellung davon zu machen oder indem er sich nur halbe und unzulängliche Vorstellungen davon macht.“ (Bourdieu 1993, 187) Auch hier sollten wir Bourdieu erweitern. Die Vorstellungen sind nicht nur symbolisch, sondern auch imaginär oder durch das Erscheinen des Realen betroffen. Das Imaginäre erfasst Bourdieu nicht hinreichend. Und das Reale deutet sich nur in seinem Wunsch an, die Praktiken möglichst unverhüllt zur Geltung kommen zu lassen. Aber dieses Nichtverhüllte ist eine Illusion des symbolisch orientierten Beobachters, und das dürfen wir nie vergessen.
(4) Insoweit ist der Platz der symbolischen Ordnung, den ich ein wenig abweichend von Bourdieus Terminologie in dem Schaubild nach meiner Rekonstruktion seiner Grundideen so nenne, ein Schlüsselort der Vermittlung einer Praxis, die den Habitus erzeugt, der symbolische Ordnungen erzeugt, die wiederum Felder der Beobachtung erzeugen, die die Praxis oder das, was wir für relevante Praxis halten, erzeugen. Bourdieu gewichtet die Ordnung dieser Erzeugungen ein wenig anders: Die Praxis konditioniert bei ihm in erster Linie den Habitus, denn dieser kann nur in ihren Grenzen wirken; der Habitus ist ein Erzeugungsmechanismus, der Schemata erzeugt; die Schemata aber wirken in einer Realität, die sich als Felder oder Positionen oder Orte gesellschaftlicher Strukturiertheit beschreiben lässt; diese Felder modifizieren die Praxis, von der aus sie explizit oder implizit konditioniert bzw. erzeugt wurden; ein unendlicher Kreislauf – wesentlich für alle sozialen Routinen – eröffnet sich.
Ein Feld bezeichnet Relationen, die in einer historischen Situation als notwendige festgestellt werden. Bei Bourdieu erscheint das von ihm definierte Feld als ein konkret gedeutetes und empirisch abgesichertes. Hier ist der Konstruktivismus vorsichtig, wenn er darauf hinweist, dass in diese Feststellung die Interessen und Machtverhältnisse der Betonung bestimmter Feldeigenschaften eingehen. Aber gleichzeitig kommt Bourdieus Ansatz dem konstruktivistischen Anliegen sehr entgegen, denn er löst das sehr verallgemeinerte Konstrukt Gesellschaft zutreffend auf. Wacquant sagt: „Seiner Meinung nach bildet eine differenzierte Gesellschaft keine einheitliche, durch Systemfunktionen, eine gemeinsame Kultur, ein Geflecht von Konflikten oder eine globale Autorität integrierte Totalität, sondern ein Ensemble von relativ autonomen Spiel-Räumen, die sich nicht unter eine einzige gesellschaftliche Logik, ob Kapitalismus, Moderne oder Postmoderne, subsumieren lassen.“ (Bourdieu/Wacquant 1996, 37).
Jedes Feld ist durch objektive Kräfte definiert, die eine relationale Konfiguration im Abgleich mit den anderen Faktoren – Praxis, Habitus, Schemata – zeigen. Wenn ich dies so umdeute, dass es hier je von den Beobachtern und einer Verständigungsgemeinschaft abhängt, die diese Objektivität als Konstrukt definiert, dann hilft uns der Ansatz des Feldes, zirkuläre Wirkungsweisen in sozialen Perspektiven auszuweisen und kritisch zu reflektieren.
Hier wird es aber entscheidend, den Begriff der Kraft weiter zu differenzieren. Kräfte, das sind strukturelle Vorgegebenheiten ebenso wie agierende Subjekte, die sich in Konflikten, in Konkurrenz, in Macht – und Verteilungskämpfen, in Beziehungen (mit all den in Kapitel III geschilderten Implikationen) bewegen. Die Unschärfe der Erkenntnisse in diesen Feldbeschreibungen rührt nicht nur daher, dass die Felder selbst unbestimmte Grenzen und Ränder aufweisen (dies entspricht der objektivistischen Verallgemeinerung bei Bourdieu), sondern darin, dass diese Unschärfen selbst durch re/de/konstruierende Beobachter in ihren Beobachtungen erzeugt werden (dies entspricht der Sicht des interaktionistischen Konstruktivismus). Die systematische empirische Anwendung fundiert für Bourdieu die Objektivität des Begriffes. Aber er gesteht durchaus zu, dass Begriffe eine systemische Definition haben und nur innerhalb des Systems Geltung beanspruchen, für das sie gebildet werden (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996, 125). Felder sind ein Konstrukt von Beobachtern, um die Beobachtungen in eine Übersicht zu bringen. Die Übersichtlichkeit erzwingt eine Wahl von Perspektiven ebenso wie eine Verengung der Blicke.
Felder erscheinen für Bourdieu als ein Netz oder „eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen. Diese Positionen sind in ihrer Existenz und auch in den Determinierungen, denen die auf ihnen befindlichen Akteure oder Institutionen unterliegen, objektiv definiert, und zwar durch ihre aktuelle und potentielle Situation (situs) in der Struktur der Distribution der verschiedenen Arten von Macht (oder Kapital), deren Besitz über den Zugang zu den in diesem Feld auf dem Spiel stehenden spezifischen Profiten entscheidet, und damit auch durch ihre objektiven Relationen zu anderen Positionen (herrschend, abhängig, homolog usw.).“ (Ebd., 127)
In den Feldern und Positionen kommen die Schemata des Wahrnehmens, Denkens und Handelns zur Geltung. Hier wird die Welt in ihrer Wirklichkeit und deren Dringlichkeit festgelegt; die Theorie erscheint als Theorie einer Praxis, die sich in Erfahrungsfeldern niederschlägt und besonders in Institutionen ihre Erfüllung findet. Dies gilt vorrangig für den Erfolg des Habitus und der durch ihn erzeugten Schemata: Hier findet eine Einverleibung statt, die sich all der Fähigkeiten bedient, ein soziales Verhältnis zu einer Institution werden zu lassen. „Das Eigentum eignet sich seinem Eigentümer an, indem es sich in Form einer Struktur zur Erzeugung von Praktiken verkörpert, die vollkommen mit seiner Logik und seinen Erfordernissen übereinstimmen. Wenn man zu Recht mit Marx sagen kann, dass ‚der Nutznießer des Majorats, der Erstgeborene, dem Boden gehört‛, dass letzterer ‚ihn erbt‛, oder dass die ‚Personen‛ der Kapitalisten ‚personifiziertes‛ Kapital seien, so liegt dies daran, dass der durch den Akt der Etikettierung (mit dem ein Individuum als Erstgeborener, Erbe, Nachfolger, Christ oder schlicht als Mann – im Gegensatz zur Frau – mit allen zugehörigen Vorrechten oder Pflichten eingesetzt wird) eingeleitete rein soziale und sozusagen magische Sozialisationsprozess, der durch Akte sozialer Behandlung verlängert, verstärkt und bestätigt wird, die den institutionellen Unterschied in eine natürliche Unterscheidung zu verwandeln geneigt sind, sehr reale, weil auf Dauer auf den Leib geschriebene und im Glauben eingeschriebene Wirkungen erzeugt. Eine Institution, zum Beispiel die Wirtschaftsform, ist nur dann vollständig und richtig lebensfähig, wenn sie dauerhaft nicht nur in Dingen, also in der über den einzelnen Handelnden hinausreichenden Logik eines bestimmten Feldes objektiviert ist, sondern auch in den Leibern, also in den dauerhaften Dispositionen, die diesem Feld zugehörigen Erfordernisse anzuerkennen und zu erfüllen.“ (Bourdieu 1993, 107 f.) Diese Position wird von Michel Foucault radikalisiert, insofern dieser vor allem auf die Macht in solchen Dispositionen abhebt (vgl. dazu weiter unten Kapitel IV.3.3.2.1).
Wollen wir den Zusammenhang zwischen Macht in den Feldern, Habitus und den symbolischen Schemata in einer sozialen Praxis aufklären, dann kommt es in den Positionen für Bourdieu vor allem darauf an, das Kapital, das eingesetzt wird, zu bestimmen. Dabei wird der von Marx gedeutete Begriff des Kapitals erheblich erweitert. Es gibt durch den Habitus als Schemata erzeugtes und in Feldern bzw. Positionen (z.B. mittels Titeln) akkumuliertes Kapital, das hier zur Geltung kommt. Es ist wie in einem Spiel: Es gibt einen Einsatz, eine Investition, die sich als symbolisches Kapital ausdrückt; es gibt ein Ergebnis, das sich als Objektivierung geltend macht; es gibt ein Interesse, das die Einverleibung von Einsätzen und Ergebnissen steuert. Für alles aber benötigen wir Anerkennungsbedingungen der Spielvoraussetzungen, einen praktischen Glauben an das Spiel, der vorgängig sein muss, damit wir überhaupt Spielraum in unseren Feldern und Positionen haben (vgl. ebd., 122 ff.). Was aber treiben die Menschen gesellschaftlich für ein Spiel?
Die vorgängige „objektive“ Wahrheit dieses gesellschaftlichen Spiels ist für Bourdieu ein nacktes Interesse und eine egoistische Berechnung. Das Interesse betont Bourdieu als eine Kategorie, die in den Spielen zum Einsatz kommt und zugleich vorausgesetzt wird. Die illusio (von ludus, Spiel) regiert hier: „Die Spieler sind im Spiel befangen, sie spielen, wie brutal auch immer, nur deshalb gegeneinander, weil sie alle den Glauben (doxa) an das Spiel und den entsprechenden Einsatz, die nicht weiter zu hinterfragende Anerkennung teilen (es gibt keinen ‚Vertrag‛, in dem die Spieler unterschreiben, dass sich das Spiel lohnt, dass es der Mühe wert ist; das tun sie, indem sie mitspielen), und dieses heimliche Einverständnis ist der Ursprung ihrer Konkurrenz und Konflikte.“ (Bourdieu/Wacquant 1996, 128) Hier kommt ein Begehren (libido) zum Ausdruck, das sich in der wechselseitigen Verschränkung bloßen Tuns und Mitmachens bei gleichzeitigen symbolischen Erklärungen über dieses Tun ausdrückt. Diese nüchterne Wahrheit ist der Motor des ökonomischen Kapitals, das die Grundlage aller weiteren Kapitalformen hergibt. Hier gilt der Gabentausch und die über ihn erzeugte Tauschstruktur als das Paradigma der Suche nach „objektiver“ Wahrheit überhaupt (Bourdieu 1993, 203). Aber eine bloß ökonomistische Sicht greift zu kurz, weil zwar Tauschverhältnisse entscheidend sind, aber stark von Gesellschaft zu Gesellschaft wechseln und eine eigene Axiomatik und Bedeutung entfalten können. „In einer Wirtschaftsform, die dadurch definiert ist, dass sie sich weigert, die ‚objektive‛ Wahrheit der ‚ökonomischen‛ Praktiken anzuerkennen, d.h. das Gesetz des ‚nackten Interesses‛ und der ‚egoistischen Berechnung‛, kann das ‚ökonomische‛ Kapital selbst nur wirken, wenn es auch um den Preis einer Rückverwandlung, die sein wahres Wirkungsprinzip unkenntlich zu machen geeignet ist, Anerkennung findet: das symbolische Kapital ist jenes verneinte, als legitim anerkannte, also als solches verkannte Kapital (wobei Anerkennung im Sinne von Dankbarkeit für Wohltaten eine der Grundlagen dieser Anerkennung sein kann), das gewiss zusammen mit dem religiösen Kapital dort die einzig mögliche Form der Akkumulation darstellt, wo das ökonomische Kapital nicht anerkannt wird.“ (Ebd., 215)
Das symbolische Kapital ist damit ein Begriff, der vor allem geeignet erscheint, auch jene Klassen zu erfassen, die nicht direkt ökonomisch produktiv sind. Analysen hierüber hat Bourdieu in seinen Forschungen umfangreich vorgenommen (vgl. z.B. Bourdieu 1993). Es dient vor allem dazu, auch eine geistige Akkumulation zu bezeichnen, die sich z.B. in Titeln, Prüfungen, symbolischen Werken usw. niederschlägt, die durch Vorführung und Inszenierung ausgedrückt wird, deren Entstehung ebenso Fragen nach Kredit wie Verfall in einer Kultur aufwirft wie das ökonomische Kapital. Schließlich steht das symbolische Kapital in Zusammenhang mit Bildungssystemen und Titelvergaben, die durch dieses erzeugt werden. Es verwandelt sich in kulturelles oder soziales Kapital.
In der Lebenswelt treten nach Bourdieu mithin verschiedene Kapitalformen auf (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996, 151 f., Liebau 1987, S.73 f.):
- Ökonomisches Kapital: Dieses ist unmittelbar an Tauschvorgänge mittels Geld und Eigentumsverhältnisse gebunden; auf dieses Kapital, das wir aus dem Alltag der Wirtschaft kennen, wird Kapital gemeinhin reduziert; für Bourdieu stellt es zwar die Basis anderer Kapitalarten dar, aber diese lassen sich nicht einfach nur auf ökonomisches Kapital reduzieren. Insbesondere bei ethnologischen Vergleichen kommt es darauf an, nicht einfach kapitalistische Strukturen auf andere Ausgangsbedingungen anzuwenden.
- Kulturelles Kapital: Dieses Kapital erscheint in verschiedenen Formen. Es ist objektiviertes Kulturkapital in Form von kulturellen Gegenständen, Bildern, Büchern, symbolischen Zusammenfassungen kultureller Texte, auch Techniken und Maschinen. Man kann es auch als Informationskapital bezeichnen. In seinen inkorporierten, objektivierten und institutionalisierten Formen1 setzt es aber individuelle Fähigkeiten voraus, erworbene und relativ dauerhafte Dispositionen im Individualhabitus, das den Gebrauch der Objektivationen rechtfertigt und ermöglicht. Als institutionalisiertes Kulturkapital gelten vor allem Titel und Leistungszuweisungen bzw. Selektionen, um kulturelle Kompetenzen und relativ dauerhafte konventionelle Werte festzuschreiben. Als anerkannte Titel legitimieren sie den Träger mit einem Status, der als Nachweis kultureller Befähigung gilt und davor schützt, diese Legitimation im Einzelfall ständig neu unter Beweis stellen zu müssen. Die Titel sind Garanten einer gewissen Zuverlässigkeit konventioneller Systeme.
- Soziales Kapital: Dieses Kapital stellt aktuelle und virtuelle Ressourcen dar, die als Netzwerk von Beziehungen fungieren und mehr oder weniger institutionalisiert auftreten. Hier machen sich Zugehörigkeiten zu Klassen bzw. gesellschaftlichen Gruppen von Menschen geltend, die aus Gründen der Nützlichkeit und Interessenverbundenheit entstehen und relativ dauerhaft Sozialbeziehungen ermöglichen, binden und erhalten können. Das soziale Kapital kann in sehr unterschiedlichen Formen auftreten. Es kann z.B. in Form des politischen Kapitals in bestimmten Gesellschaften erhebliche Profite und Pfründe abwerfen und Privilegien erzeugen, ohne dass die Nutznießer direktes ökonomisches Kapital besitzen.
- Symbolisches Kapital: Diese Kapitalform fasst die bisherigen unter der Perspektive einer legitimierten Wahrnehmung zusammen. Alle drei genannten Kapitalformen werden als symbolisches Kapital eingesetzt, wenn es um ihre Erscheinung als Renommee, Status, Prestige usw. geht. Man könnte dies auch als soziales Kapital auffassen, aber der Begriff symbolisches Kapital verdeutlicht stärker die Als-ob-Stellung der Kapitalarten: Sie fungieren als ob sie direkt in der Wahrnehmung auftreten könnten, obwohl sie stets symbolisch als Träger bestimmter Perspektiven und Interessen eingesetzt werden. Bourdieu macht insbesondere auf die Verkennung aufmerksam, die das symbolische Kapital erzeugt: „Dieses symbolische Kapital ist die verherrlichte Form so platt objektiver Realitäten, wie sie die von der Sozialphysik registrierten, also Schlösser oder Ländereien, Eigentums-, Adels- oder akademische Titel annehmen, wenn sie durch die verzauberte, mystifizierte und einvernehmliche Wahrnehmung verwandelt werden, die das Wesen des Snobismus (oder, auf anderer Seite des Dünkels, der Kleinbürger) ausmacht.“ (Bourdieu 1993, 255) Das symbolische Kapital ist als Ausdruck von Wahrnehmungen wirksam in der Beurteilung von Verteilungskämpfen in der Gesellschaft. Individuelle und kollektive Kämpfe bestimmen die Durchsetzung einer „legitimen Definition der Wirklichkeit“, „deren symbolische Wirkung dazu beitragen kann, die bestehende Ordnung, d.h. die Wirklichkeit, zu erhalten oder zu untergraben.“ (Ebd., 258)
Blicken wir auf diesen Aspektreichtum des Werkes von Bourdieu, dann hilft er uns – neben der beziehungsorientierten und dabei auch subjektorientierten Sichtweise, die der Konstruktivismus stärker einbringt – strukturelle Fragen nach materieller und institutioneller Organisiertheit nicht zu übersehen. Die sozialen Praktiken als sprachliche Kommunikation in der Lebenswelt sind auch nicht allein kognitiv oder in sprachlicher Analyse zu interpretieren. Nehmen wir die Analyse der Beziehungswirklichkeit aus Kapitel III auf, dann erkennen wir verwickelte Interaktionsbeziehungen, in denen immer ein bezogenes soziales Verhältnis ausgedrückt wird. Diese Bezugnahme schließt imaginäre und symbolische Inanspruchnahmen und Zurechnungen ein. Dies bedeutet, dass Menschen sich wechselseitig wie Dinge oder Sachen beanspruchen können, dass sie sich in ihren Inanspruchnahmen oder Zurechnungen z.B. gegenseitig verwalten, versachlichen, disziplinieren und verdinglichen. Hier zeigen sich die Objektfallen, die wir reflexiv bewältigen müssen. Ein Blick auf die vielgestaltigen Praktiken zeigt die unendlichen Möglichkeiten dieser Beanspruchungen. In ethnologischen Vergleichen ist dies immer wieder dokumentiert worden. Es lässt sich aber auch an beliebigen kommunikativen Situationen unserer Alltagswelt demonstrieren. Und hier helfen die analytischen Kategorien Bourdieus uns weiter, wenn wir sie in Beobachterkategorien umsetzen:
- Auch der interaktionistische Konstruktivismus richtet sein vorrangiges Interesse in der Lebenswelt auf die Praxis. In ihr walten Praktiken, Routinen und Institutionen, über deren soziale Konstruktion sich Beobachter aufklären müssen, um nicht in einer unbemerkten Gefangenschaft unreflektiert zu verfahren. Aber hier lauern zugleich auch die Objektfallen, in die man gerät, wenn man das „Deutungsmonster“ einer logischen und objektiven Lebensweltanalyse voll entfaltet. Der konstruktivistische Anspruch muss bescheiden bleiben: Wir analysieren bestimmte Beobachterstandpunkte bestimmter Verständigungsgemeinschaften. Allerdings müssen wir lebensweltlich zugestehen, dass solche Verständigungen und Gemeinschaften bereits Voraussetzung einer sozialen Konstruktion von Wirklichkeit sind, mithin auch unserem scheinbar freien konstruktivistischen Entwurf innewohnen.
- Insoweit ist eine Suche nach einem Habitus hilfreich, um ein gerade für Beobachter und Beobachtungsgemeinschaften sozial vorgängig definiertes dispositives System zu rekonstruieren, das Maßstäbe der eigenen Re/De/Konstruktionen schafft. Insbesondere die soziale Eingebundenheit des Wissenschaftlers in Interessen- und Machtlagen – und nicht eine vermeintliche oder angebliche, immer illusionäre Wertfreiheit – sind hier zu nennen.
- Die symbolisch erzeugte Ordnung wird durch einen Habitus in bestimmter Praxis erzeugt. Bourdieus Ansatz, sofern wir ihn nicht objektivierend übertreiben, vermag uns zu helfen, der Erzeugung kritisch nachzuspüren und die Interessenbezogenheit hierbei stets zu reflektieren. Dies ist besonders auch für den Konstruktivismus wesentlich, da wir so den Fehler vermeiden, das konstruktivistische Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschema als universelles misszuverstehen und aus seinen sozialen Entstehungsbezügen naiv zu entfernen.
- Felder zu ermitteln und Positionen auszumachen, dies ist ohnehin für eine konstruktivistische Arbeit entscheidend. Aber auch hier kann mit Bourdieu ein präzisierender Blick in Bezug auf lebensweltliche Verhältnisse geleistet werden, wenn die dabei eingesetzten Interessen- und Machtmittel nach Kapitalarten unterschieden werden. Dies wird in jedem Einzelfall einer sozialen Konstruktion von Bedeutung sein können.2
- Praktiken lassen sich in der Lebenswelt kaum als singuläre, individuelle, detailgetreue Ereignisse beschreiben. Als soziale Praktiken fixieren wir eine bestimmte Beobachterperspektive, die uns eine Logik einer Praxis vorführt. Insoweit verfährt Bourdieu konsequent, wenn er nach einer solchen Logik sucht. Auch wenn er den Objektivismus dabei mitunter zu übertreiben scheint, so helfen seine Kategorien als Beobachtermaßstäbe durchaus, Praktiken differenziert zu untersuchen. Wir fragen nach einer Praktik nicht nur, indem wir narrativ Eindrücke schildern oder oberflächlich Beobachterbruchstücke zusammentragen, sondern wir müssen uns bemühen, den Zusammenhang von Praktik, sozialem Habitus (als Ausdruck einer bestimmten sozialen Beziehungswirklichkeit), symbolischer Ordnung und eingesetzten Feldern/Positionen der Beobachtung zu entwickeln. Hierfür stehen konstruktivistische Überlegungen bisher noch aus (vgl. deshalb weiterführend Kapitel IV.4).
- Routinen sind als Praktiken nicht bloße Wiederholungsmuster, sondern stellen ein komplexes Geflecht aus konstruierten (subjektiven) Erwartungen und vorkonstruierten (objektiven) Chancen dar. Auch hier reicht es wie bei den Praktiken nicht aus, sie bloß zu beschreiben und in ihren Wirkungen darzustellen. Routinen sind in der Lebenswelt vor allem deshalb interessant, weil sich in ihnen der Habitus und die symbolische Ordnung stets schon als Position vollziehen, die praktisch zu hinterfragen ist. Ordnungen setzen sich oft als selbstverständlich voraus, weil sie tief als konstruierte Deutung in den Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata verwurzelt sind, sich durch einen Habitus stets neu herstellen, und über genügend Kapital (in einer oder mehrerer seiner Arten) verfügen. Die Routine ist dann nur ein äußerer Ausdruck und Schein dieses Vorgangs.
- Institutionen sind immer auch Praktiken und stellen routinierte Vorgehensweisen her. In der staatlichen Institutionalisierung ist ein Konzentrationsprozess verschiedener Macht- und Kapitalsorten zu erkennen. Der Staat kontrolliert die verschiedenen Kapitalsorten (z.B. ökonomisch durch Steuern, kulturell durch Verteilungen und Kontrollen von Selektionen, sozial durch Verwaltungen und Parteien, aber auch rechtlich, militärisch und im ganzen symbolisch), wobei verschiedene Einfluss- und Machtfelder aufgerichtet werden, die als Meta-Kapital auch Macht über andere Kapitalsorten ausüben. Dies bedingt, dass diejenigen, die mit ihren Kapitalsorten um Macht und Einfluss kämpfen, vor allem um die Macht im Staat kämpfen (vgl. Bourdieu/Wacquant 1996, 146). Insoweit lehnt Bourdieu Modelle des Staates oder der Gerechtigkeit oder des Rechts ab, die sich frei von Macht zu definieren versuchen. Gerade die modernen Institutionen lassen sich nicht bloß als rationale Praktiken bestimmen, sondern bedingen eine präzisere Analyse des Wechselspiels von Praktiken, Routinen und Institutionen in der Praxis, die mit einem Habitus verschiedener Akteure (überwiegend im Spiel um egoistische Interessen und nackte Berechnung) im Zusammenhang stehen, die dabei bestimmte Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata erzeugen, die wiederum in Feldern und Positionen realisiert sind, die wir als Struktureigenschaften von Gesellschaften definieren können. In diesem Kreislauf ist kein Moment entbehrlich, und auch konstruktivistische Beobachter kommen nicht um mindestens diese Analysepunkte herum, wenn sie hinreichend weit die Lebenswelt in ihren Praktiken, Routinen und Institutionen beobachten wollen.
Nun könnte man diesen Beobachtungsdefinitionen vorwerfen, dass sie nicht hinreichend sind. Und als Konstruktivisten fällt mir dies – anders als Bourdieu – auch nicht schwer. Eine totale oder vollständige Analyse erscheint mir als unmöglich. Aber es sollte mindestens gefragt werden, was angesichts der derzeitigen Verhältnisse eine sozial-kulturell viable Analyse ist. Auch die Verständigungsgemeinschaft der Konstruktivisten hat sich jeweils zu entscheiden, wie weiträumig und wie weit und tief angelegt Lebensweltanalysen vorzunehmen sind. Im Blick auf die Objektfallen der gegenwärtigen Lebenswelten scheint ein konstruktivistisch umgedeuteter Zugang vermittelt über Anstöße, die uns Bourdieu gibt, sinnvoll. Wir haben uns mindestens dem Wechselspiel von subjektiver Setzung als Voraussetzung einer Lebenswelt und den schon sozial vorausgesetzten Setzungen in der Lebenswelt zu stellen. Bourdieus Ansatz scheint in dieser Hinsicht günstig zu sein. Er kann weiterentwickelt oder dekonstruiert werden, um sich dem Problem der Objektfallen zu stellen.
Drei Lücken in dem Modell Bourdieus will ich abschließend hervorheben. Erstens fällt auf, dass Bourdieu die Seite der Beziehungswirklichkeit in der Lebenswelt unterschätzt. Da er die subjektive Seite ausblendet, hat er keinen so breiten Zugang zur Beziehungswirklichkeit, wie er mir notwendig erscheint (vgl. Kapitel III. und IV.3.3.3). Zweitens hat er die Machtfrage nicht hinreichend differenziert (vgl. Kapitel IV.3.3.2). Drittens unterschätzt seine Theorie das Imaginäre und das Virtuelle. Diesem Aspekt will ich – den anderen beiden vorausgreifend – im nächsten Kapitel näher nachgehen.
3.3.1.2 Virtuelle und imaginäre Objektivierung
Was treibt eine Gesellschaft dazu an, ihre Symbolwelten zu vergrößern, ihr Ordnungssystem zu entfalten und zu vervielfältigen, sich zu entwickeln, zu verändern, vielleicht auch zu zerstören? Ich rekonstruiere solchen Antrieb, indem ich nach Motivationen suche, die hinter den äußeren Erscheinungsformen liegen. Hier bieten sich insbesondere zwei Dimensionen an: Das Imaginäre erscheint als ein Vorstellungsraum, der menschliches Begehren (im Streben nach wechselseitiger Anerkennung) mit der Ordnung der Dinge (über eine Ordnung der Blicke) und Lebenswelt vermittelt. Das Reale hingegen erscheint als Grenzbedingung gegen die schon errichtete Realität, die in der Gegenwart brüchig und für die Zukunft riskant erscheint.
Sowohl im Imaginären als auch im Realen zeigen sich Beobachterperspektiven, die ich schon mehrfach als unscharf hervorgehoben habe. Gleichwohl zeigen sich hier perspektivische Zugriffe auf die Lebenswelt, die mit einem Sinn verbunden werden, der zwar nicht funktional in einer Ordnung von Lebenswelt aufgeht, der aber als Vorstellungsraum und -sinn solche Ordnungen antreibt und motiviert. In den Lebensformen, den kulturellen Lebensinhalten und Lebensstilen finden Beobachter diese perspektivischen Zuschreibungen, die nicht allein aus der bestehenden symbolischen Realität einer Gesellschaft erklärt werden können.
Cornelius Castoriadis hält deshalb die Gesellschaft für eine imaginäre Institution (1990). Seine These lautet: „Jenseits der bewussten Tätigkeit der Institutionalisierung finden die Institutionen ihren Ursprung im gesellschaftlichen Imaginären.“ (Ebd., 225) Dieses Imaginäre setzt der Ordnung der Welt, dem Symbolischen, Ziele und verhilft so zu seiner Orientierung. Castoriadis geht davon aus, dass es bei der Beschreibung von gesellschaftlichen Institutionen nicht ausreichen kann, sie als äußere Maschinerien und Bürokratien zu begreifen. Es geht auch darum, die Antriebe eines Symbolsystems bloßzulegen, und diese Antriebe wurzeln für ihn in Bedeutungen, die sich vorrangig auf Wahrgenommenes, Rationales und Imaginäres beziehen (ebd., 241). Der Bezug auf Wahrnehmbares zielt auf den Beobachterbereich der Realität, das Rationale auf die Gedankenwelt (und darin das Symbolische), das Imaginäre auf das Vorstellen von Menschen schlechthin.
Castoriadis übernimmt seine Dreiteilung von Lacan (vgl. nochmals Band 1, Kapitel II.3.5). Gleichzeitig ist er ein entschiedener Kritiker Lacans (vgl. 1983, 59 ff.). Dies bezieht sich vor allem auf die Definition des Imaginären: „Wer das Imaginäre auf eine simple ‚Spiegelung‛ herunterbringt (also auf das bloße ‚Bild von‛ etwas schon Bestehendem, Vorherbestimmtem, also auch Determiniertem) und es in jämmerlicher Konfusion mit einem ‚Trugbild‛ und einer ‚Illusion‛ verwechselt, der ist endgültig außerstande, das Subjekt als radikale Imagination, als unbestimmbare, unbegrenzte und unbeherrschte Selbstveränderung zu erkennen.“ (Ebd., 69) Und hieran schließt er eine Kritik am mangelnden gesellschaftlichen Sinn Lacans und der Lacan-Schüler an: Sie bringen das Subjekt in eine einsame Position und vernachlässigen seine gesellschaftlichen Einbindungen. In der Therapie passen sie das Individuum überwiegend nur an gesellschaftliche Erfordernisse (im Sinne eines guten symbolischen Funktionierens) an (ebd., 100). Und sie münden in einen Meisterdiskurs, der den Meister Lacan verherrlicht und seinen Aussagen quasi Gesetzeskraft einräumt. Wenn überhaupt, dann erscheint hier ein (nicht hinterfragter) Gesellschaftsbezug der Lacan-Schule.
Nun sollten wir die beiden Argumentationsteile auseinanderhalten. Der Mangel an gesellschaftlicher Analyse ist für Lacan offensichtlich. Lacan steht in der dritten Kränkungsbewegung und nicht in einer lebensweltlichen oder gesellschaftlichen Zusammenschau auch anderer Kränkungen im Blick auf Gesellschaftsphänomene. Dies macht die Enge seines Ansatzes im Blick auf gesellschaftliche Phänomene aus. Aber dies bedeutet nicht, dass das Imaginäre bei Lacan auf eine simple Spiegelung reduziert wird. Castoriadis seinerseits vernachlässigt die zweite Kränkungsbewegung. Er sieht nicht, dass die Interaktion als spiegelndes und gespiegeltes Anerkennungsverhältnis maßgebend für jede Imagination ist, sondern reduziert das Imaginäre auf ein Substanzdenken hin. Das Imaginäre verwandelt sich so zu einer Art Triebkraft, die jedem Individuum im Kern zu eigen ist.
Gehen wir dieser Bestimmung des Imaginären ein wenig näher nach (vgl. Castoriadis 1990, 244 ff.). Zunächst unterscheidet Castoriadis das Imaginäre vom Symbolischen. Wenn ein Subjekt Imaginäres erlebt, dann träumt es oder gibt sich z.B. einer Fantasie hin. Es erzeugt dabei Bilder. Aber sind diese Bilder nicht schon Symbole?
Ein Symbol, so argumentiert er, steht für etwas anderes, aber das Imaginäre steht für sich. Der Selbstbeobachter, das Subjekt, realisiert die Imaginationen nicht auf einer symbolischen Ebene. Wird die Imagination symbolisch, dann kann ein Beobachter fragen, was der Grund dieser Symbolisierung ist. So gelangen wir zum Grundfantasma des Subjekts, zu seiner Kernszene, die alle Setzungen des Subjekts antreibt und bestimmt. Hier liegt ein radikal Imaginäres zugrunde: „In dem Maße jedoch, wie das Imaginäre letztlich auf eine ursprüngliche Fähigkeit zurückgeht, sich mit Hilfe der Vorstellung ein Ding oder eine Beziehung zu vergegenwärtigen, die nicht gegenwärtig sind (die in der Wahrnehmung nicht gegeben sind oder es niemals waren), werden wir von einem letzten oder radikalen Imaginären als der gemeinsamen Wurzel des aktualen Imaginären und des Symbolischen sprechen.“ (Ebd., 218) Nun entsteht aber die Frage, wie dieser Kern selbst, dieses radikal Imaginäre, entsteht.
Auf diese Frage verweigert Castoriadis die Antwort. Das radikal Imaginäre selbst erscheint zwar als innerer Quell, aber er ist zugleich unzugänglich. Das sich in ihm ausdrückende individuelle Unbewusste äußert sich nur abgeleitet und mittelbar. Es zeigt sich als „Abstand zwischen dem Leben und der tatsächlichen Organisation einer Gesellschaft“. Aber auch das Leben selbst erweist sich als undefinierbar (ebd., 246). Die imaginären Bedeutungen zeigen sich „als die jedem gesellschaftlichen Raum eigentümliche Krümmung, als der unsichtbare Zement, der den ungeheuren Plunder des Realen, Rationalen und Symbolischen zusammenhält, aus dem sich jede Gesellschaft zusammensetzt – und als das Prinzip, das dazu die passenden Stücke und Brocken auswählt und angibt.“ (Ebd.). Und das gesellschaftlich Imaginäre ist keinesfalls der Ausdruck bloß einer Summe von individuellen, imaginär zusammengesetzten Leistungen einzelner Subjekte. Zwar erscheint es Castoriadis als unstrittig, dass eine gesellschaftliche imaginäre Bedeutung auch im Unbewussten von Individuen Anhaltspunkte finden muss, aber das gesellschaftlich Imaginäre erscheint oft eher als Voraussetzung denn als Resultat eines solchen Vorgangs (ebd., 247 ff.). Deshalb lautet die These: „Der Einzelne kann private Phantasmen, nicht aber Institutionen hervorbringen.“ (Ebd., 248)
Das radikal Imaginäre dient nach diesen Bestimmungen im wesentlichen dazu, ein produktives, kreatives, offenes Bedeutungsuniversum zu erzeugen, das mit geschichtlichem Tun verbunden ist. Castoriadis verweist in dieser Festlegung insbesondere auf Fichtes „produktive Einbildungskraft“, die als Faktum menschlichen Geistes weder begründet noch begründbar ist. (Ebd., 251) So entgeht Castoriadis dem Dilemma, die symbolischen Bedeutungen bloß als Abbild einer schon existierenden Gesellschaft zu sehen, was es schwer machen würde, die Unbestimmtheit und Offenheit gesellschaftlicher Entwicklung selbst zu thematisieren. Das radikal Imaginäre treibt uns zu Schöpfungen an. Das Imaginierte aber hat sich schon niedergeschlagen, und solch Imaginiertes wird zum Ausgangspunkt weiterer Bestimmungen. Diese Schöpfung von Bedeutungen wird zwar durch das Reale (im Sinne von Wahrnehmung einer Realität verstanden) und Rationalität im Rahmen geschichtlicher Kontinuität begrenzt, aber es stellt den Grundstock für die motivierten Veränderungen und Auswahlmöglichkeiten dar, die wir haben. Wenn Gesellschaften fragen, wer sie sind, wo sie sind, was sie wollen und begehren, was ihnen fehlt, wenn sie kurzum ihre Identität suchen, dann liefert eine Analyse der imaginären Bedeutungen eine Antwort (ebd., 252). Diese Bedeutungen begründen die Wahlen, die Auf- und Abwertungen von Gegenständen, die Orientierungen einer Gesellschaft (ebd., 258 f.). Insbesondere der Marxismus hat das Imaginäre unterschätzt (ebd., 259 ff.), auch wenn Marx im Fetischcharakter der Ware schon eine Skizze des Imaginären in der kapitalistischen Ökonomie geliefert hat (ebd., 271 f.). Castoriadis führt eine ganze Reihe von Phänomenen in der modernen Welt auf, die vom Imaginären angetrieben werden (ebd., 268 ff.):
- die kapitalistisch erzeugten Bedürfnisse, die einen willkürlichen, unnatürlichen, künstlichen Charakter tragen und das Imaginäre benutzen;
- die Verdinglichung und Technisierung des Menschen, die die Person in künstliche Faktoren zerlegt und einen systematischen Machbarkeitswahn erzeugt;
- die Fetichisierung der Warenwelt, die zu Imaginationen über Schönheit, Jugend und weitere Zuschreibungen ausgebreitet wird;
- die bürokratische Organisation, in der das Fantasma der Organisation als „gut geölte Maschine“ erscheint oder in der „wohlintegrierte Persönlichkeiten“ imaginiert werden.
Da Castoriadis in seiner Definition des Imaginären den Spiegelungsvorgang verleugnet, hat er allerdings Schwierigkeiten, das Imaginäre noch sinnvoll vom Symbolischen zu unterscheiden. So, wie er das Imaginäre gebraucht, wirkt es stets schon symbolisch. Deshalb sagt er: „Dieses Imaginäre fungiert nicht nur als Rationales, sondern ist bereits eine von dessen Formen, enthält dieses Rationale in ursprünglicher und unendlich fruchtbarer Ununterschiedenheit und weist bereits Spuren unserer eigenen Rationalität auf.“ (Ebd., 279)
Hier nun wird deutlich, dass Castoriadis überwiegend der ersten Kränkungsbewegung verhaftet ist und diese gegen die zweite und dritte abwehrend wendet. Er versucht allein, einen kausalen Antrieb für jene Unbestimmtheiten des Gesellschaftlichen zu finden, die eine Veränderungsmöglichkeit signalisieren. Dabei rächt sich, so denke ich, die vorschnelle Abwehr des Interaktionsproblems in mehrfacher Weise:
- Castoriadis entgeht insbesondere die Notwendigkeit einer Beobachtertheorie. Er situiert das Imaginäre bloß als eine Art eingepflanztes Vorstellungsmotiv, ohne seine interaktive Dynamik, die dabei auftretenden unterschiedlichen Beobachterperspektiven (und insoweit widersprüchlichen Deutungen) hinreichend zu beachten. So entgeht ihm die Spannung, die dem Imaginären als Bild von einem anderen mit dem Begehren dieses anderen in ständiger interaktiver Rückwirkung innewohnt.
- Er vereinfacht völlig unverständlich die Spiegelung als eine Determination, weil er sie nicht kommunikativ deutet, sondern nur über die Inhaltsseite wahrnimmt. Er stellt sich nicht der Beziehungswirklichkeit, sondern sucht im Gesellschaftlichen selbst eine Imagination, die das Subjektive in einen Rahmen stellt. Da er hierbei keine Situierung von Beobachtern vornimmt, die die Perspektivität dieser Wahl problematisieren, gerät er in nicht hinterfragte Konstruktionen: Etwa, wenn er „natürliche Tatsachen“ als Grundlage gesellschaftlicher Imaginationen bestimmt und Naturtatsachen als unwandelbar behauptet (ebd., 385); etwa, wenn er spekuliert, dass das radikal Imaginäre noch der tiefsten Triebregung vorausgeht, weil es den Trieben überhaupt erst ermöglicht, Vorstellungen (Kern- oder Ursprungsfantasmen) anzunehmen (ebd., 476); etwa, wenn er das Unbewusste als Wahrnehmung des Selbst, als Selbstwahrnehmung und Selbstvorstellung bestimmt. Diese Konstruktionen sind durch und durch problematisch: In den naturalisierten Tatsachen steckt stets der beobachtende Konstrukteur, den Castoriadis zu wenig kritisch thematisiert. Die Behauptung unwandelbarer Naturtatsachen benötigt er nur, um seine eigene Legitimation als letzte Wahrheit auszugeben. Dabei erzeugt er vereinfachte Abhängigkeitsschlüsse: Inwieweit imaginäre Vorstellungen den Trieben vorausgesetzt sein müssen, erscheint als wenig schlüssig. Castoriadis sucht nach einer letzten Monadologie der Welt, einem Baustein der Einheit (ebd., 490 ff.), einer Prä-Identifikation, die alle weiteren anleitet. In dieser linearen Denkweise aber konstruiert er dann ein monadologisches Selbst, das im Unbewussten von allen Rückkopplungen mit Anderen entbunden wird. Wie aber soll solch ein Selbst ohne Andere überhaupt definierbar sein? Dies geht nur als eine letzte Substanz, die wie der unbewegte Beweger des Aristoteles, auf den Castoriadis immer wieder zurückgreift, alles weitere in Bewegung setzt. Und diese Einseitigkeit verfehlt die Bestimmung des Imaginären, wie ich sie sehe, vollständig.
- Nur aus dieser vereinfachten Konstruktion ist verständlich, weshalb Castoriadis die Spiegelungen bloß als Trugbild und Illusionen sieht. Er sucht im Imaginären noch den wahrhaften Antrieb, der alles Reale – Objekte und andere Menschen – aus sich heraus – aus seiner Monadologie – entwirft (ebd., 505). Dabei entwickelt er selbst eine illusionäre Welt, wenn er etwa behauptet, dass Kinder im Sprachlernen zunächst eine Privatsprache bilden (ebd., 510). Es ist umgekehrt ja genau das Ziel des Sprachlernens, dies zu verhindern (zum Privatsprachenproblem vgl. in Band 1 meine Argumentation zu Wittgenstein). Immer wieder wird Castoriadis nun Opfer seines monadologischen Konstrukts. Nach und nach muss er in dieses die Perspektive auf Andere, auf gesellschaftliche Funktionen und Koordinationen einführen, und es scheint für ihn so, als würde diese Monade wie ein Fass mit den Inhalten der Lebenswelt aufgefüllt, um ein letztes, „endgültiges Identifikationsmodell“ aufzurichten (ebd., 521). Immerhin findet dieses Identifikationsmodell in der Einzigartigkeit der schöpferischen Imagination eines jeden Individuums zumindest einen Gegenpol (ebd.). Aber er kann in seiner Suche nach einer Wahrheit, einer Metaphysik des Imaginären, in der Spiegelung nur ein Abbildproblem entdecken und erkennt nicht, dass die Spiegelungen gerade Abbild- oder Widerspiegelungstheorien zerstören. Dies entgeht ihm, weil er die imaginäre Achse der Kommunikation übersieht, weil er überhaupt Interaktion nicht als grundsätzliches Verhältnis menschlicher Lebensweise, sondern bloß als sekundäres Produkt eines erzwungenen Umgangs miteinander interpretiert.
Für den interaktionistischen Konstruktivismus kann die Theorie von Castoriadis eher zur Abgrenzung, aber keinesfalls zur systematischen Begründung herangezogen werden. Aber er macht uns auf einige Aspekte aufmerksam, die eine weitergehende Beachtung verdienen:
Lässt sich das Imaginäre auf ein radikal Imaginäres zurückführen?
Imaginationen habe ich bisher stets als Vorstellungen aufgefasst. Solche Vorstellungen sind Bilder, Figuren, Zeichen in allen Gestaltmöglichkeiten. Das Vorstellen selbst ist ein komplexer Vorgang, der immer auch Emotionen einschließt. Unsere körperliche Verfassung spielt in diesen Vorgang hinein und wird durch ihn verändert. Das Vorstellen selbst geschieht aber nicht monadisch oder autistisch, sondern stets in einem Bezug auf andere/s. Die Unschärfen des Vorgangs, die individuellen, subjektiven Vorlieben und Erlebnisse, verhindern hier eine Deutung, die einen Ursprung, einen Kern oder auch nur ein Schlüsselszenarium für ausschlaggebend gegenüber anderen Faktoren erklärt. Dies bedeutet nicht, dass in den beobachtenden Konstruktionen, die später alle auf der symbolischen Ebene stattfinden, solche Deutungen nicht möglich oder sinnvoll wären, aber sie sind gegenüber dem Imaginären bloße Re/Dekonstruktionen, um das uns ansonsten Unverständliche, Offene, Kreative zu beseitigen. Hier setzt die von mir bestimmte imaginäre Verdichtung ein, die in den Spiegelungen selbst das Vorstellen auf bestimmte Perspektiven verengt und zentriert. Es wird immer interessant sein, sich nach solchen Verdichtungen und auch möglichen Verschiebungen zu befragen. Allerdings geschehen die Befragungen aus wissenschaftlicher Sicht immer aus einer symbolischen Perspektive heraus. Hier ist die Suche nach einem radikal Imaginären als letzter, übergreifender Struktur bloß ein Versuch einer Vereinheitlichung, die uns meist in vorschnelle Reduktionen führt. Hingegen ist die Betonung des Spiegelungsvorgangs der Versuch, die Komplexität des Imaginären auch als Unterschiedlichkeit verschiedener Beobachterperspektiven in uns und außerhalb von uns zu sichern. Dabei gehe ich von dem Konstrukt aus, dass in der Spiegelung Anerkennungswünsche des Subjekts im Blick auf andere notwendig erscheinen, da sich kein Selbst ohne die Auseinandersetzung mit anderen (imaginär) als Spiegelung und mit Anderen (symbolisch) als Bildung/Sozialisation/Enkulturation bestimmen kann.
Ist das Imaginäre dem Symbolischen selbst inhärent oder in ihm präsent?
Vereinfacht sagen wir oft, dass in diesem oder jenem (symbolisch vermittelten) Bild, in einer Figur, in einer Metapher, in einem Schema usw. das Imaginäre selbst sichtbar wird. Wir sehen diese symbolisierte Präsentation, z.B. das Bild eines Malers, und geraten schnell in eigene Imaginationen. Oder wir meinen, in diesem Bild spontan die Imagination eines Anderen zu erblicken. Insoweit erscheint das Imaginäre als dem Symbolischen schon einverleibt, als in ihm ausgedrückt. Wir rekonstruieren uns ein Begehren, das hier wirkt und welches wir nachvollziehen, indem wir es z.B. nacherleben.
Wichtig ist es hier, daran zu erinnern, dass die Unterscheidung zwischen Imaginärem und Symbolischem nur eine Verschiebung der Beobachterperspektive ist. Wir sind in jedem Moment unseres Erlebens in einem ständigen Übergang: Zwischen den imaginierten und symbolisierten Vorstellungen herrscht ein steter Fluss, ein Austausch, ein Automatismus oft, mitunter eine vertiefende Reflexion. In dem Moment, wo wir die Bilder, Figuren, die fließenden Gestalten in ihren unterschiedlichsten Formen uns in Sprache übersetzen, verwandeln wir das Imaginäre ins Symbolische. In dem Moment, wo wir uns unser Bild des anderen in sein Bild in uns zurückverwandeln und dies dann auch noch ausdrücken, indem wir mit ihm oder Anderen darüber sprechen, wechseln wir von der imaginären in die symbolische Beobachterposition. Es ist der Sinn dieses unterscheidenden Konstrukts, unsere Beobachterpositionen mehr auf unsere Innen- oder Außenperspektive zu situieren. Aber dabei ist es notwendig, zuzugeben, dass die Übergänge vom Imaginären ins Symbolische und umgekehrt immer von der Art der Darstellung und den Einstellungen der Beobachter abhängen. Insoweit gehört es zu den Sprachspielen auch interaktionistischer Konstruktivisten, sich miteinander darüber zu verständigen, ob und inwieweit sie etwas eher auf der imaginären Seite vorstellen oder schon – z.B. über Metaphern – auf der symbolischen Seite argumentieren. Wesentlich ist, dass dies für den Selbst- und Fremdbeobachter jeweils ganz unterschiedlich wahrgenommen werden kann.
Gibt es imaginäre gesellschaftliche Institutionen?
Institutionen sind immer symbolisch geformte Organisationen, denen kein imaginäres Eigenleben zukommt. Aber sie sind über die Beobachter immer auch mit Imaginationen verbunden. Insoweit ist es notwendig, zwei verschiedene Beobachterperspektiven zu unterscheiden: Imaginär beobachten wir die Antriebe, Motivationen, aber auch Sorgen und Ängste, die sich im Blick auf Institutionen entwickeln; symbolisch stehen diese Institutionen in ihren Funktionen, in ihrer Bürokratie, ihrer Differenzierung vor uns. Der imaginäre Bereich ist notwendig unschärfer. Er ist affektuell aufgeladen und bei Menschen sehr unterschiedlich. Der symbolische Bereich hingegen drängt uns in eine Ordnung, die relativ allgemeingültig und allgemein verbindlich sein soll. Dort, wo die Institutionen unbegreiflich bleiben – sehr deutlich bei Franz Kafka beschrieben – werden wir des Imaginären gewahr.
Eine wichtige Frage lautet, inwieweit die Allgemeingültigkeit, die allgemeine Verbindlichkeit und damit eine hohe Wirksamkeit von Institutionen dann aber nicht eine imaginäre Voraussetzung trägt, sei es, dass man ihnen z.B. intuitiv die Lösungen zutraut, die versprochen sind, oder so viel Angst vor ihnen hat, dass das getan wird, was verlangt scheint.
Die Beantwortung dieser Frage ist nicht ganz leicht. In einer Hinsicht stimmt es wohl, dass es eine imaginäre Voraussetzung der symbolischen Institutionen geben muss. Dies betrifft das Begehren nach immer höherer Symbolisierung, die sich in Institutionen ausdrückt. Hier scheint eine offensichtliche Lust am Funktionieren, an einer begrenzenden Ordnung und dabei auftretenden Zwängen zu walten, die uns antreibt und motiviert, die Institutionalisierungen ständig zu verbessern und die Organisationsformen hierfür zu erhöhen. Das 20. Jahrhundert ist bis in die Freizeitindustrie hinein von diesen Prozeduren angefüllt. Kafkas Visionen von einer abgehobenen Bürokratie und einem nicht mehr durchschaubaren Entscheidungsvollzug dokumentieren sehr anschaulich die Kehrseite dieser Lust: Sie erzeugt eine Angst vor den symbolisch geformten Übermächtigkeiten, die aus der subjektiven Kontrolle geraten sind. Sowohl was diese Lust als auch die Angst betrifft, wirken imaginäre Prozesse ganz entscheidend ein. Sie wurden von mir nach den Seiten imaginärer Verdichtung und Verschiebung in Kapitel III deshalb ausführlich als Beobachterperspektiven beschrieben. Es erscheint als möglich und sinnvoll, diese Aspekte weiter zu differenzieren, wenn lebensweltliche Analysen vorgenommen werden.
In anderer Hinsicht, nämlich dann, wenn wir auf das bloße Funktionieren solcher Symbolsysteme schauen, blenden wir das Imaginäre analytisch nun gerade aus, um uns eine Übersicht über die funktionelle Differenzierung selbst zu erhalten. Dies ist schon für Weber, deutlicher dann bei Parson und Luhmann erkennbar und durchgeführt. Sofern wir beachten, dass diese Analysen die erste Hinsicht nicht befriedigen, können wir mit ihnen gleichwohl in einer symbolischen Perspektive viel erreichen. Sie helfen uns, die symbolischen Vorrichtungen und Vorkehrungen zu entschlüsseln, die das symbolische System als Referenz seines Funktionierens erzeugt und machen uns sogleich auf jene Prozeduren aufmerksam, die das Imaginäre begrenzen. Sie zeigen gesellschaftliche Institutionen ausschließlich als symbolische. Aber diese engere Sicht wird dann aufgebrochen, wenn man sich intensiver den Praktiken und Routinen in Institutionen selbst zuwendet: In allen Praktiken, Routinen und Institutionen spielt das Imaginäre als ein unausgesprochenes, teilweise unbewusstes, offenes und kontingentes Band (in den wechselseitigen Spiegelungen der Akteure/Teilnehmer/Beobachter) eine wesentliche vermittelnde Rolle.
Was unterscheidet das Imaginäre vom Visionären?
In den Visionen, Hoffnungen, Wünschen, die unterschiedliche symbolische Bevorzugungen von Menschen ausdrücken, schwingt als Hintergrund, als Antrieb, als Motivation und Begehren immer auch etwas Imaginäres mit. Sofern dieses Imaginäre für den Selbstbeobachter unbewusst oder undurchschaubar bleibt, fühlt er sich zwar angetrieben, etwas zu tun, aber er kann keine hinreichende Beobachtungstheorie hierüber entwickeln. Er spricht dann vielleicht so: „Ich fühle mich irgendwie angetrieben.“ „Es könnte hieran oder an den und den Faktoren liegen, warum ich das tue.“ „Ich weiß ja selber nicht, weshalb ich dies so gemacht habe.“ Oder stärker visionär: „Ich fühle eine Kraft in mir, die sagt, dass es genau so richtig und sinnvoll ist.“
Castoriadis benutzt in dieser Weise den Begriff des Imaginären oft. Er meint etwas, das ich als Visionäres bezeichne. Ein schon symbolisch erfasstes, angetriebenes, motiviertes, begehrtes Thema, eine Intention, ein Symbol usw. Auch hier hängt die Grenze zum Imaginären ganz von den Vorstellungen der Beobachter ab. „Ich verspüre ein ozeanisches Gefühl.“ Der eine wird sagen, dass dies bereits eine symbolische Metapher für ein Begehren ist. Er fragt dann vielleicht nach: „Und dieses Gefühl hast Du immer dann, wenn Du sie siehst?“ So versucht er einen Sinn, eine symbolische Vermittlung in das imaginäre Vorstellen hineinzubringen. Aber das ozeanische Gefühl mag für einen anderen Beobachter noch gar nicht dermaßen vorgeklärt sein. Er weiß dann nicht, was imaginär bezeichnet werden soll. Er nimmt den Ausspruch zwar als eine symbolische Äußerung wahr, aber er vermutet dahinter eine Imagination, die ihm noch unzugänglich scheint.
3.3.1.3 Produktion oder Konstruktion?
Marx beschreibt zu Beginn seines „Kapitals“ die moderne Gesellschaft als Ausdruck einer ungeheuren Warenansammlung. In ihr vergegenständlichen sich Gebrauchswerte, deren Nutzen uns veranlasst, sie zu konsumieren, aber zugleich sind in ihnen auch Tauschwerte ausgedrückt, die sich am allgemeinen Äquivalent ihres Wertebezugs, dem Geld, tauschen. Wir mögen uns noch so sehr als Konstrukteure unserer modernen Lebenswelt begreifen, gerade die Funktionen des Warenmarktes, des Geldes, des Tausches und der Produktion von Mehrwert und Profit zeigen für Marx, dass jeder Erfinder (Konstrukteur) im Kapitalismus bereits Erfundener (Reproduzent) ist. In den „Thesen über Feuerbach“ legt Marx deshalb dar, dass die Erzieher und Veränderer von Wirklichkeit nie vergessen dürfen, dass sie bereits durch diese Wirklichkeit verändert und erzogen wurden. Deshalb ist ein ideologiekritisches (dekonstruktives) Verfahren für Marx wesentlich, um nicht Erscheinungen einer Sache und ihr Wesen (den Hintergrund) in Eins fallen zu lassen und naiv vorzugehen.
Dieser zirkuläre Anspruch deckt sich mit dem Konstruktivismus, wenn ich Rekonstruktion, Konstruktion und Dekonstruktion als drei Seiten konstruktivistischer Beobachterperspektiven aufstelle. Aber im Blick auf die Rolle der Produktion gibt es doch einen wichtigen Unterschied, den ich hier nur kurz thematisieren will.
Marx bemüht sich, strikte Beobachtungen gegenüber der kapitalistischen Ökonomie und mit ihr verbundener funktionaler Handlungen zu betreiben, weil er von einem spezifischen Beobachterkonstrukt ausgeht: Die lebensweltlichen Verhaltensweisen im Kapitalismus tragen für ihn eine materielle Basis, die er in der Dialektik von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen aufspürt. Hierin kommt das zirkuläre Paradox des Menschen in einer jeweils gedoppelten Bewegung zum Ausdruck: Einerseits ist er als Produktivkraft mit jenen Wissenschaften und Techniken immer schon befasst, die er vorfindet, andererseits aber ist er auch schöpferische Kraft, die die Produktivkräfte fortentwickeln kann; einerseits ist er den herrschenden Klassen- und Eigentumsverhältnissen unterworfen, andererseits kann er sie als revolutionäre Klasse stürzen. Das Primat der Produktion basiert bei Marx im wesentlichen auf einer Anerkennung des zivilisatorischen Fortschrittscharakters der Produktivkräfte. Diesen konstruktiven Kräften traut er zu, die Menschheit in eine glückliche Phase eines Zustandes des Überflusses zu bringen. Aber das Glück hängt für ihn von der Verwirklichung einer Revolution der Produktionsverhältnisse ab, die erst einmal die Gleichheit der Menschen im Blick auf Eigentum an Produktionsmitteln und Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums herstellen müssten. Marx beobachtet, dass alle menschlichen Konstruktionen nämlich durch den Vorrang dieser Produktionsverhältnisse immer schon gedeutet und bestimmt sind: Macht- und Interessenfixierung, ungleiche Aneignung und Ausbeutung, ungleiche Verwirklichungschancen und Mächtigkeiten, eigene Konstruktionen durchzusetzen.
Die Umsetzung der Marxschen Ideen in die sozialistischen oder kommunistischen Bewegungen ist ein exzellentes Beispiel, die analytische Wirksamkeit einer interaktionistisch-konstruktivistischen Beobachtertheorie nachzuweisen. Ich will dies hier zumindest andeuten.
Was bei Marx zunächst eine Beobachterperspektive der Kritik des Kapitalismus war, wird in den Perspektiven der – von Marx auch intendierten und mit eingeleiteten – politischen Bewegung zum Deutungsmuster einer Verständigungsgemeinschaft, genauer etlicher sich um die „wahren Linien“ einer „wahren Auslegung“ streitender Verständigungsgemeinschaften. Innerhalb solcher Verständigungsgemeinschaften nimmt die Marxsche Analyse jeweils einen begründenden Platz ein. Für alle diese Gemeinschaften wird es entscheidend, eine symbolische Lösung (Revolution im großen setzt die kleinen Revolutionen in den Köpfen voraus) durchzuführen, die in eine rechte Lehre mündet (vgl. insbes. Laclau/Mouffe 1991). Das Wesen dieser Lehre besteht immer wieder darin, die durchaus interessante Beobachterkonstruktion des Kapitalismus, die Marx entwickelt hat, als die Wahrheit eines realen Kapitalismus zu zeigen. Dies geht mit der erkenntnistheoretischen Behauptung eines Abbild- oder Widerspiegelungskonzeptes einher, das sich sicher weiß, dass die eigene Konstruktion die Wirklichkeit selbst darstellen kann. Die Entwicklung dieser revolutionären Bewegung ist bekannt und sicherlich nicht unschuldig am Entstehen des Konstruktivismus als alternativer Erkenntnistheorie. Die revolutionären Verständigungsgemeinschaften fixierten dort, wo sie an die Macht kamen, enge Produktionsverhältnisse, die zwar ein kapitalistisches Eigentum im großen Maßstab zu unterbinden suchten, aber Ware-Geld-Beziehungen ebenso wie im Kapitalismus entfalteten. An die Stelle ökonomischen Kapitals trat in diesen Gesellschaften ein bürokratischer Funktionärsapparat, der sein soziales (oder besser politisches) Kapital zur eigenen Bereicherung benutzte. Das Ziel, revolutionär eine Herrschaftsfreiheit oder klassenlose Gesellschaft zu erreichen, scheiterte in doppelter Hinsicht: Einerseits erwiesen sich die Produktivkräfte nie als wertneutral genug, um über Erfindungen und Gestaltungen des Maschinen- und Industriezeitalters dem Menschen eine universelle, nicht-entfremdete Basis seines Tuns zu geben; andererseits führten die Revolutionen gegenüber den kapitalistischen Produktionsverhältnissen nach und nach zu Gegenrevolutionen (also Aufhebungen des kommunistischen Kurses in immer mehr Ländern), die zu Beginn des 21. Jahrhunderts den Kapitalismus als stärker denn je zeigen.
Aus konstruktivistischer Sicht sehe ich hiermit mehrere Aspekte meiner Theorie sehr gut illustriert:
- Die Verständigungsgemeinschaften mit ihren jeweiligen Beobachtern bilden einen zugelassenen Rahmen von Weltinterpretation, der jeweils zu definieren gestattet, was konstruktiv gesagt werden kann und was nicht. Dem Marxismus ist keine Universalisierung seiner Verständigungsgemeinschaften gelungen, was seine mangelnde Durchsetzungsfähigkeit zeigte. Aber zugleich haben die damit verbundenen Bewegungen auch gezeigt, wie sehr Massen mit einer klaren Abbildungs- und Wahrheitstheorie der gesellschaftlichen Wirklichkeit mobilisiert werden können, weil hier etwas eindeutig versprochen werden kann, was scheinbar klarer Analyse unterliegt. Hätten die Beobachter das Konstrukt von Marx als ein mögliches Konstrukt unter etlichen anderen sehen können, dann wäre es kaum politisch so wirksam geworden.
- Das Marxsche Konstrukt hat die Menschen unter eine stark vereinheitlichende, verallgemeinerte und abstrakte Perspektive gestellt, obwohl es durch die Beschreibung von vorhandenen Unterdrückungsverhältnissen in großen Teilen nachvollziehbar war. Dennoch hat es, trotz aller Anprangerung von gesellschaftlicher Unterdrückung, kaum einen Zugang zu den Beziehungsnöten und lebensweltlichen Verstrickungen von Subjekten gefunden. Insbesondere hat es die interaktiven Beziehungen der Menschen fast ausschließlich über eine Fixierung bestimmter materieller gesellschaftlicher Verhältnisse, d.h. in struktureller Hinsicht, wahrgenommen. Die Unterschätzung des subjektiven Faktors führte dann zu einer Leerstelle in den politischen Bewegungen, die mit Macht- und Interessenlagen gut gefüllt werden konnten, weil es in der politischen Bewegung selbst kein hinreichendes dekonstruktivistisches Kriterium gab, das die Macht- und Interessenpositionen, subjektives Begehren und Lust auf die Gestaltung eigener Bedürfnisse hinterfragen konnte.
- Der Vorrang der Produktion vor jeder Konstruktion verleitete immer wieder zu einfachen kausalen Bestimmungen. Mit der Produktionsbegründung scheint die Begründung für Kapitalismus schlechthin gegeben. Man muss sie erfassen, wenn man verstehen will, wie Kapitalismus funktioniert. Aber man erfasst damit nicht, inwieweit und inwiefern man mit dieser These konstruiert. Würde man dies erfassen, dann wäre die abgeleitete Lösung längst nicht so sicher. Hätte Marx gesagt: „Das Modell, das ich mir gebildet habe, um die Waren-Produktionsverhältnisse des Kapitalismus zu deuten, sieht folgendermaßen aus“, dann wären von vornherein die Verständigungsgemeinschaften aufgefordert worden, dieses Modell stets neu in ihren Beobachtungen zu prüfen und zu modifizieren. Ganz anders lautet es, wenn man sagen kann: „Die Wahrheit des Kapitalismus ist die folgende...“ In diesem beobachtenden und fragenden Mangel steckten und stecken bis heute marxistische Bewegungen fest. Sie sind in einem konstruierten Dogma ge- und befangen, was innerhalb solcher Verständigungsgemeinschaften zu ständigen Macht- und Rangkämpfen um die richtige Lehre führt. Der Stalinismus war dafür nur eine der brutaleren und wissenschaftlich gesehen sehr dummen Formen.
- Der Vorrang der Produktion verwies schließlich immer wieder auf eine materielle, diesseitige, dingliche Sicht von Welt, die als Konstrukt einfacher in Argumentationen zu überführen ist als die unschärfere der Imaginationen oder subjektiver, singulärer Ereignisse. So konnte sich der Beobachter in diesen Bewegungen stets über sich selbst täuschen: „Du musst nur mehr Verzicht üben, mehr wagen, mehr ertragen, usw., wenn du das große Ziel am Ende erreichen willst.“ Letztlich bedeutete dies fast immer einen Rückfall in einen Meister- bzw. Herrendiskurs, der auf dem Platz des Einen, von wo aus die Argumentationen starten, schon die Wahrheit zu sitzen hatte, die eigentlich erst (vor allem praktisch) zu begründen gewesen wäre (vgl. Kapitel IV 4.2).
Nun ist diese kritische Einschätzung sehr stark auf die Art der Konstruktion (= Abbildungsvorwurf) und die rigide Form der Verständigungsgemeinschaft (= Vorwurf geschlossener Beobachtungsformen) gerichtet. Gleichwohl leistet der Marxismus, insbesondere aber Marx selbst, etwas Dekonstruktives, das für eine kritische Analyse des Kapitalismus als auch für eine kritische Einschätzung des Konstruktivismus wesentlich wird:
- Als Fremdbeobachter haben Marxisten (bei gleichzeitiger Teilnahme an kapitalistischen Strukturen) fundamental zur Kritik und Dekonstruktion des kapitalistischen Systemdenkens beigetragen. Als Kritiker sind sie deshalb unverzichtbar, weil sie gerade gegenüber jenen bornierten kapitalistisch orientierten Denk- und Begründungsschulen, die sich ihr System nur schönreden, hinreichend differenzierte Beobachtungen und Argumente beibringen, die zur Dekonstruktion einer kapitalistischen Herrschaftsform führen. Insoweit lohnt es gerade heute wieder, sich intensiv mit der marxistischen Kritik am Kapitalismus zu beschäftigen. Es wird für denjenigen, der die Marxsche Theorie nicht kennt, überraschend sein, wie viele kapitalistische Phänomene der Gegenwart sich immer noch nach dieser Theorie kritisch deuten lassen (vgl. auch Reich 1988, 241 ff.).
- Aus marxistischer Sicht ist der Konstruktivismus eine viel zu relativierende Sicht von Welt. Daraus lassen sich mindestens zwei Kritiken ableiten:
(1) Machbarkeitsideologie: Der Konstruktivismus erscheint als reine Machbarkeitsideologie, so dass sich das, was kapitalistisch gesehen herrscht, durchsetzt. Die ständig relativierende Sichtweise verhindert ein klares politisches Programm, das sich für die Interessen von Unterdrückten, Minderheiten, Verfolgten einsetzt. Der Konstruktivismus hat keine klare Weltsicht, so dass er nicht gezielt gegen Ausbeutung angehen kann. Er betont den Beobachterstandpunkt, wobei die Reflexion gegenüber der verändernden Tat in den Vordergrund rückt. Konstruktivisten interpretieren – als Steigerungsform zu aller bisherigen Philosophie – die Welt nur verschieden, aber es kommt darauf an, sie zu verändern.
(2) Repressive Toleranz: Die Beobachtervielfalt, die der Konstruktivismus fordert, und die Toleranz, die gegenüber den Beobachtungen Anderer geübt werden soll, erschleichen eine Repression, die aus jeder Toleranz gegenüber einem unterdrückenden Herrschaftssystem entstehen. Solange Konstruktivisten nicht erkennen, dass sie schon vorgängig unterdrückt sind (durch Herrschaft), werden sie (unbewusst) diese Herrschaft zementieren helfen, obgleich sie meinen, im Sinne von Pluralität, Offenheit und Toleranz zu sprechen.
Als wesentliche konstruktivistische Erwiderung gegen den Relativismus müsste der Konstruktivismus Re/Dekonstruktionen vorweisen, die ihn nicht als naive Machbarkeitstheorie ausweisen. Hier ist eine Hinwendung zur Lebenswelt – und dabei zur Produktionswirklichkeit – erforderlich. Gleichwohl sehe ich die Machtfrage differenzierter, als es in dieser möglichen Kritik am Konstruktivismus lautet. Nehmen wir also diese Kritik als dekonstruktiven Impuls und schauen wir, ob der Konstruktivismus mehr als Relativierungen aufweist, die alles legitimieren könn(t)en.
3.3.2 Machtfallen
3.3.2.1 Macht als universale Kraft?
Im Blick auf die Analyse von Macht hat insbesondere Foucault zur Entlarvung eines humanwissenschaftlichen Anspruchs beigetragen, der sich in seinen Setzungen über sich selbst täuscht.3 Foucault knüpft hierbei insbesondere an Bataille an, für den der Begriff des Heterogenen maßgeblich wurde. Heterogen, „so nennt er alle Elemente, die sich der Assimilation an bürgerliche Lebensformen und an die Routinen des Alltags ebenso widersetzen, wie sie sich dem methodischen Zugriff der Wissenschaften entziehen. In diesem Begriff kondensiert Bataille die Grunderfahrung der surrealistischen Schriftsteller und Künstler, die darauf aus sind, gegen die Imperative des Nützlichen, der Normalität und der Nüchternheit die ekstatischen Kräfte des Rausches, des Traumlebens, des Triebhaften überhaupt schockierend aufzubieten, um die konventionell eingeschliffenen Wahrnehmungs- und Erlebnisweisen zu erschüttern.“ (Habermas 1991 a, 249) Hier sind Grenzüberschreitungen bezeichnet, die neben dem Eindringen in archaische Verbote (Bataille) auch durch die Entdeckung der Träume und der Triebe (Freud), die Wiederentdeckung des Tragischen und Archaischen (Nietzsche), die Entdeckung der orientalischen Welt (Schopenhauer) charakterisiert sind.4 Grenzüberschreitungen markieren nach Habermas einen Ausbruch aus dem „Universum der welthistorisch siegreichen Vernunft des Abendlandes“ (ebd., 250), wobei Bataille das Prinzip der Moderne nicht an einem autonomen Subjekt, an einem bodenlosen Selbstbewusstsein festmacht, sondern dieses Subjekt in der „Erfolgsorientierung eines nutzenoptimierenden Handelns“ situiert, in dem sich die subjektiven Ziele dieses Subjekts verwirklichen (ebd., 251). Foucault knüpft dort an Bataille an, wo dieser nicht nur wissenschaftliche Texte, sondern alle möglichen Entäußerungsformen aufnimmt, um dem vermeintlichen Triumph des bürgerlichen Erfolges zu entgehen. In „Wahnsinn und Gesellschaft“ (1973) beschreibt er die Zirkularität der bürgerlichen Vernunft, die sich nur von sich selbst unterscheiden kann, indem sie die Unvernunft bzw. deren Spielarten als Wirklichkeit entwickelt. Er denkt in seiner Argumentation oft zirkulär, ohne sein Denken im von mir gebrauchten Sinne als zirkulär zu bezeichnen. Aber indem er zeigt, dass die Vernunft den Wahnsinn benötigt, um sich durch Ausschließung, Verfemung und Ausgrenzung selbst als Vernunft sicher zu werden, beschreibt er die Konstruktion eines komplementären Verhältnisses, das wir wie einen Zirkel deuten können. In dieser Zirkularität beobachtet die Vernunft sich selbst an ihren Unterschieden, an den ausgegrenzten, abgewehrten, den verfemten und ausgeschlossenen Anderen, die sie benötigt, um sich unterscheiden zu können. Was „Wahnsinn und Gesellschaft“ über die „kulturgeschichtlich angelegte Studie eines Wissenschaftshistorikers hinaushebt, ist ein philosophisches Interesse am Wahnsinn als einem Komplementärphänomen zur Vernunft: den Wahnsinn hält sich eine monologisch gewordene Vernunft vom Leibe, um sich seiner gefahrlos als eines von vernünftiger Subjektivität gereinigten Gegenstandes bemächtigen zu können.“ (Habermas 1991 a, 280) Insoweit streitet der Logos dieser Vernunft gegen das Keimen des Heterogenen, gegen die Versuchungen von Grenzüberschreitungen – ein Kampf bis in die Gegenwart.
In den frühen Arbeiten Foucaults ist dabei noch eine Suche nach dem Ungesagten, nach der Spur dessen erkennbar, was hinter den Dingen steckt, nach der dunklen, gemeinsamen Wurzel von Vernunft und Wahnsinn. Habermas verweist hier auf eine Gemeinsamkeit zur negativen Dialektik der Kritischen Theorie (Horkheimer, Adorno), die mit den „Mitteln des identifizierenden Denkens“ zugleich dieses überschreiten will, die in der Entstehungsgeschichte der Dialektik der Aufklärung einen ursprünglichen Ort sucht, an dem sich die Spaltung einer Vernunft vollzieht, die ihrer eigenen Mimesis – ihrer wahren oder wahrhaften Grundlage – entgeht. „Wäre das seine Absicht, müsste Foucault archäologisch herumklettern in der Trümmerlandschaft einer zerstörten objektiven Vernunft, aus deren stummen Zeugen sich retrospektiv immer noch die Perspektive einer (wenn auch längst widerrufenen) Versöhnungshoffnung formen lässt.“ (Ebd., 283) Das ist Adornos Weg.5 Bei Foucault hingegen finden wir die Ernüchterung, die sich auf die Entlarvung einer Vernunft ohne Hoffnung auf Versöhnung ihrer Misere findet.6 Um so klarer sieht er dabei die Machtfallen der modernen Welt- und Produktionswirklichkeit.
In der „Geburt der Klinik“ sagt Foucault (1991), dass er hinter den Ereignissen nicht mehr eine tiefere Hermeneutik suchen will. Damit sucht er auch im Heterogenen nicht mehr nach verborgenen Verheißungen, sondern macht allein eine nüchterne Archäologie zu seiner Aufgabe.7 Eine solche Archäologie sucht nach Bruchstellen, die an Veränderungen in der Zeit festgemacht werden können. Es sind dies die Stellen der Entwicklung neuer Paradigmen und des Untergangs alter Sichtweisen. So kommt eine Beobachterperspektive ins Bild, die ihr Wissen aus den Daten schürft, die sie rekonstruieren kann. Allerdings beschränkt sich Foucault hierbei nicht auf die Diskurse der sich entfaltenden und widersprechenden Vernunft selbst, sondern sucht in den Praktiken, den Anwendungsfeldern, die solcher Vernunft einen Hintergrund geben, die Zirkularität auf, die uns schon in dem Komplementaritätsverhältnis von Vernunft und Wahnsinn begegnete. Insoweit sind Foucaults Arbeiten interessant für eine zirkuläre Beobachtertheorie, auch wenn er bei seiner Analyse andere Formulierungen als die hier bevorzugten wählt.
Foucault wählt eindringliche Bilder, um unsere Beobachterstandpunkte aufzudecken. So zitiert er Borges, nach dem sich in „einer gewissen chinesischen Enzyklopädie“ die Tiere „wie folgt gruppieren: a) Tiere, die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte Tiere, c) gezähmte, d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) herrenlose Hunde, h) in diese Gruppierung gehörige, i) die sich wie Tolle gebärden, k) die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind, l) und so weiter, m) die den Wasserkrug zerbrochen haben, n) die von weitem wie Fliegen aussehen.“ (Foucault 1993a, 17)
Die in dieser Tiergruppierung auftretenden Namen sind uns vertraut. Wir haben sowohl ein Verständnis für die jeweilige Lautgestalt der Wörter, den Ausdruck des Bezeichnenden, also den Signifikanten, als auch ein Verständnis des Bezeichneten, des Bedeutungsinhaltes, des Signifikates. Dennoch bleibt die Unmöglichkeit, das zu denken, was das Zitat sagt. Foucault stellt die Frage, was denn diese Unmöglichkeit ausmacht, um als Antwort zu enthüllen, dass die Unmöglichkeit in der fehlenden Verbindung der „Ordnung der Dinge“ liegt; dies lässt uns lachen, aus Verlegenheit, weil sich hier die Begrenztheit unserer Ordnungssuche zeigt. Die Ordnung ist das „innere Gesetz“ der Dinge, das geheime Band und Netz, die Richtung und Besonderheit der Wahrnehmungen (vgl. ebd., 22).
Allerdings gilt es, mindestens zwei Ordnungen zu unterscheiden. In dem Zitat begegnen uns Worte, die wir als begriffene in unserer Sprache ausweisen können: Sie haben alle ihre Geschichte, ihre Abstammung und ihre Gegenwartsbedeutung, die zwar zum Teil schwer lokalisierbar und uneindeutig sein mag, die aber dennoch eine Ordnung darstellt, die wir markieren können. Auch Uneindeutigkeit, Widersprüchlichkeit gehört zu unseren Versuchen, Ordnung des Bezeichneten zu gewinnen. Auf der anderen Seite ist die Logik des Zusammenhangs der Begriffe miteinander, die ordnende Klassifikation, für uns bei fremden Ordnungen nicht durchschaubar: Genau dies macht es uns in diesem Beispiel unmöglich, das zu denken.
Das Zitat verfremdet damit unser vertrautes Denken, es ist Anreiz zum Lachen oder zum Nachdenken. Ähnlich geht es uns, wenn wir uns in die Kultur eines fremden Volkes hineinwagen, besonders dann, wenn es sich um Völker mit scheinbar frühen, uns fremd erscheinenden menschlichen Lebensformen handelt. Es kann uns auch so gehen, wenn wir uns auf den Prozess der „theoretischen Neugierde“ (vgl. Blumenberg 1980) einlassen, der in der Zunahme der Erkenntnis die vertrautesten Ordnungsmuster zerstört. Aber auch in unserer direkten Nähe gibt es solche Unvertrautheiten: Die Psychoanalyse charakterisiert sie als aufsteigende Muster unseres Unbewussten, einer Ordnung, die wir in unseren Träumen erahnen und in den neurotischen Erkrankungen nachempfinden können. Trotz aller Begriffe und Klassifikationen erreicht die Ordnung dabei ihre Grenzen. Foucault versteht es, uns insbesondere als Ethnologe unserer eigenen Kultur zu begegnen, indem er wie ein Fremder in sie zurücktritt.
Ordnung konstituiert sich zunächst (nach Foucault besonders bis zum 16. Jahrhundert) durch Ähnlichkeit. Dies ist für frühe Völker besonders charakteristisch. Ähnlichkeit ergibt sich, so Foucault (1993 a, 46 ff.) durch „convenentia“, indem Ähnlichkeit durch eine nachbarschaftliche Nähe räumlich erzwungen erscheint (Ort und Ähnlichkeit), durch „aemulatio“, indem das Ähnliche vom Ähnlichen gespiegelt wird, nachgeahmt, in Wetteifer gerät (Reflex und Ähnlichkeit), durch Analogie, indem Ketten von Verknüpfungen gebildet werden, in deren Mittelpunkt zumeist der Mensch steht (Mehrwertigkeit und Reversibilität universalisieren die Ähnlichkeiten), durch Sympathie bzw. Antipathie, indem die Anziehung bzw. Abstoßung die drei vorgenannten Figuren aufnehmen. Diese Bedingungen der Ähnlichkeit bedürfen jedoch ihres Auftretens in der Signatur; sie müssen an der Oberfläche der Dinge signalisiert werden (ebd., 56), denn nur so ist ein Wissen über Ähnlichkeiten erreichbar und analysierbar. So war die Ähnlichkeit ursprünglich unsichtbar, aber die Signatur kehrt dies an das Licht des Sichtbaren. Deshalb ist nach Foucault die Welt voller Zeichen, Wappen, Symbole, Hieroglyphen usw. In der Sprache tauchen die Ähnlichkeiten ineinander, Analogien werden durch nachbarschaftliche Nähen und reflexartige Nachahmungen gebildet, Sympathien und Antipathien charakterisieren ihrerseits die Verkettungen.
Dies deckt sich mit meiner Darstellung der Kränkungsbewegungen. In ihnen wurde die Heraufkunft des Beobachters verknüpft mit der zunehmenden Bedeutung des Symbolischen gedacht. Eine Zunahme des Symbolischen – mehr desselben, wie wir mit Levinas sahen – reduzierte aber auch immer den Anderen, um sich als Macht zu etablieren und darin zur Falle zu werden. Dieser Falle will ich nun näher nachspüren.
Wenn ich dabei Foucaults Analysen herausgreife, dann muss ich sie zunächst auf den eigenen Argumentationsgang, insbesondere der Kränkungsbewegungen, zurückbeziehen. Dominiert bei Foucault nicht die erste Kränkungsbewegung? Und ist die Macht in seinem Denken nicht eine Vereinfachung und Universalisierung?
Foucault sucht in der Tat nach Invarianten oder invarianten Elementen unter den Verschiedenheiten der Oberfläche.8 Hierbei ist die Kategorie der Ähnlichkeit zunächst bloß eine formale, so dass auch das Analyseergebnis eher die formellen, in den Arbeiten Foucaults besonders die institutionellen Aspekte berücksichtigt, die er am Beispiel von schriftlichen Quellen erforscht. Foucault sieht dabei seine vorherrschende Beschäftigung mit sprachlichen Phänomenen als nur vorläufig an, als einen notwendigen Zwischenschritt. Sein Ansatz, der sich selbst nicht prinzipiell als strukturalistisch versteht, verdeutlicht ein breiteres Herangehen als andere Strukturalisten: Er definiert seine strukturierende Position zunächst als den Versuch, in der Geschichte der Wissenschaft jenen unbewussten, wenngleich gesetzmäßigen, Teil freizulegen, der ihre Entwicklung, Zwänge und Episoden bestimmt, und aufzuzeigen, dass die Geschichte der Wissenschaft nicht allein dem Gesetz des Fortschritts der Vernunft folgt (vgl. Foucault in Reif 1973, 180).
In seiner Arbeit „Die Ordnung der Dinge“, die den Untertitel „Eine Archäologie der Humanwissenschaften“ trägt (Foucault 1993 a), zeigt er, dass die Geschichtsschreibung in ihren traditionellen Formen es unternahm, die „Monumente der Vergangenheit“ in Dokumente zu verwandeln und diese reden zu lassen. Für Foucault ist Geschichte das, was die Dokumente in Monumente verwandelt, was die Spuren, die von den Menschen hinterlassen wurden, dechiffriert und als Archäologie wirkt. Was jedoch soll im Rahmen dieser Archäologie aus der unendlichen Fülle der Möglichkeiten behandelt und untersucht werden, wie kann sich die Geschichtsanalyse von horizontalen auf vertikale Ebenen beziehen? Michel Foucault meint: „Dazu will ich Ihnen sagen, dass es wirklich keine Auswahlpräferenzen geben sollte. Man muss imstande sein, alles zu lesen, alle Institutionen und Praktiken zu kennen. Keiner der in der Ideengeschichte und Philosophie traditionell anerkannten Werte darf als solcher akzeptiert werden“ (Foucault in Reif 1973, 150). Es geht um eine Spurensicherung, die zugleich mehr als Sicherung der Erscheinungsformen sein soll. Foucault strebt die Analyse des Untergrundes an. Er konkretisiert dies in unterschiedlichen Arbeiten, aber der umfassende Anspruch, alles lesen zu können, überfordert auch ihn. Die Geschichte stellt sich ihm daher zunächst vor allem in dreifacher Weise als methodologisches Problem dar (vgl. ebd., 157 ff.):
(1) Man hat sich dem schwierigen Problem der Periodisierung zu stellen, wobei die von politischen Revolutionen bestimmte Periodisierung sich nicht immer als beste mögliche Einteilungsform erweist.
(2) Periodisierungen heben bestimmte Schichten der Geschichte hervor, umgekehrt erfordern verschiedene Schichten unterschiedliche Periodisierungen. So kann man zu unterschiedlichen Periodisierungen und Ereignisebenen gelangen, was sich in einer komplexen „Methodologie der Diskontinuität“ ausdrückt.
(3) Der Gegensatz von Humanwissenschaften (synchronischer oder entwicklungsloser Bereich) und Geschichtsforschung (Bereich des unaufhörlichen Wandels) verschwindet: „Der Wandel kann Gegenstand einer strukturalen Analyse sein, die historische Abhandlung wird mit Analysen bereichert, die aus der Ethnologie und der Soziologie, den Humanwissenschaften entnommen sind. In die historische Analyse werden sehr viel mehr Beziehungs- und Verknüpfungsformen eingeführt als allein die universale Kausalitätsbeziehung, durch die man die historische Methode hat bestimmen wollen“ (ebd., 158).
Durch Foucaults Herangehen wird daher vielfach jene Kausalität destruiert, die vor allem in marxistischen Periodisierungsbemühungen oder in anderen aufklärerischen Darstellungen eines „wahren“ Verlaufs der Geschichte wurzelten. Sein Ansatz blieb umstritten und trug ihm einen Vorwurf von zu schnellen, zum Teil auch irrationalen oder zu stark verallgemeinernden, Urteilen ein. Hier schienen seine eigenen Entwürfe nicht minder auf eindeutige Wahrheit angelegt zu sein, wie jene, die er vehement kritisierte. Entscheidend bleibt für mich jedoch Foucaults Methode gegenüber bloßen Einzelresultaten. Und hier ist es gerade das Schwanken zwischen einer eindeutigen Fundierung und der Bereitschaft, die Unschärfe in die Eindeutigkeiten eindringen zu lassen, was seinen Ansatz spannend werden lässt. Dabei musste sich Foucault nach und nach vom Versuch einer strukturalistisch orientierten – entsubjektivierten – Theorie befreien, um zugleich im Diskurs und den Dispositiven der Macht einen über die Subjekte universal wirkenden Zusammenhang zu behaupten. Ist diese Behauptung stichhaltig? Dies wird uns in erster Linie nachfolgend beschäftigen.
Bei Foucaults Methode geht es um die Rekonstruktion unserer Vorstellungswelten, wobei Regeln der Produktion dieser Welten deutlich gemacht werden sollen. Hier gibt es keine Abbildungsgesetze, sondern systemische Wechselwirkungen in der Produktion von Wissen, das sich durch die Verarbeitung dieses Wissens in der Verständigung selbst mit produziert und durch bestimmte Institutionen und damit gesellschaftliche Durchsetzungsweisen der Ordnung der Dinge hergestellt wird. Damit tritt sowohl ein konstruktiver wie auch zirkulärer Charakter der Wissensproduktion klar hervor. Foucault konzentriert sich methodisch aber nicht so sehr auf das Wissen in seinem Vernunftgebrauch, der durch Zeichen und Sprache, durch introspektive Prüfung des Bewusstseins entschleiert werden soll, sondern wendet sich konsequent der gesellschaftlichen Praxis zu, deren soziokulturelle Kontexte er forschend zu bearbeiten sucht. Dabei behauptet er einen Vorrang der Praxis bzw. untersuchten Praktiken vor der Theorie. Und hier entdeckt er die Wurzeln einer fundamentalen Kritik an der Aufklärung und ihren universalisierenden Tendenzen der Vernunftbestimmung. Er spricht bei seinem Projekt übertreibend sogar von einer Anti-Wissenschaft, um zu signalisieren, dass seine Auffassung das „Ende des Menschen“ charakterisiert. Aber von einem solchen Ende kann nicht die Rede sein. Foucault meint das Ende eines bestimmten Weltbildes vom Menschen, das diesen quasi abgehoben von seiner sozialen Praxis als autonomes und reines Vernunft-Subjekt feiert, ohne es in seinen – ganz und gar nicht den Autonomieidealen entsprechenden – Kontexten überhaupt zu rekonstruieren.
Die Ähnlichkeit der Argumentation mit Ethnomethodologen (Garfinkel u.a.) ist deutlich, allerdings bei Foucault historisch gewendet. Die Vieldimensionalität seines Vorgehens jedoch ist – durchaus im positiven Sinne – verwirrend und lässt seinen Fokus oft unscharf erscheinen. Wenn Foucault Ereignisse und Erscheinungen wie Gefängnisse, Psychiatrien, das Erziehungswesen, die Architektur usw. dechiffrieren will, so ist die Komplexität hoch. Die Formationsregeln aufzudecken, insbesondere Methoden des Vergleichs zu entwickeln, um das Beziehungsgefüge transparent zu machen, dabei strukturale Formationen zu erheben, die unabhängig von individuellen Intentionen wirken, das ist Foucaults Programm. Foucault stellt sich die Aufgabe, die Dialektik von Fremdherrschaft – im jeweils gegebenen institutionellen Rahmen, in den Spuren der Formationen des Bedeutsamen – und Selbstbestimmung – im Freiheits- und Kritikraum jenen Festgelegtheiten gegenüber – aufzuklären.
Nehmen wir den wissenschaftlichen Diskurs auf der einen Seite und die Praktiken, die mit ihm zirkulär verknüpft sind, auf der anderen Seite, dann enthüllt Foucault, wie die Imaginationen der Vernunftdiskurse auf die Beziehungswirklichkeit niederschlagen und in dieser selbst brüchig gegenüber den eigenen Ansprüchen werden. Irrenhäuser, Kliniken, Gefängnisse, Kasernen, künstliche Lernwelten nach dem Muster von Internierung, Züchtigung, Kontrolle, Zwängen gegen Körper und Geist werden exemplarische Belege für eine Vernunft, die mit ihrer Praxis zirkulär verknüpft ist.
Das Fehlen einer zirkulären Beobachtertheorie lässt uns allerdings in einem gewissen Zweifel, wie sich wissenschaftliche Diskurse und Praktiken gegeneinander verhalten. Je nach dem zeitlichen Entstehungskontext von Foucaults Arbeiten treten in strukturalistischer Perspektive Struktur und Ereignis als Kategorien hervor, die Erfolg in der Beschreibung versprechen. Die Frage der Struktur dominierte dabei eine ganze Weile durch die weit verbreitete marxistische Sicht, die die Frage nach Basis und Überbau in den Vordergrund stellte, um die Determiniertheit der Ereignisse durch Strukturen zu betonen. Aber gegenüber den marxistischen Analysen – vgl. zur Absetzung Foucaults vom Marxismus z.B. Balibar (1991) –, die über eine große Forschungsperiode seines Lebens in Frankreich dominant waren, erkennt Foucault im Detail immer wieder die Zirkularität, die sich bis zu systemischen Eskalationen steigern kann: Eine einmal errichtete Institution als Praktik einer Vernunft steigert die Erwartungen an den Diskurs der Vernunft, um sich dadurch als Praktik zu verfestigen. So verliert der kausale Bezug auf ein Muster seine Schärfe und Eindeutigkeit in der Zirkularität, da die Praktiken immer gewisse Spielräume zulassen.
Dieses Wechselspiel weist in seinem Zirkel Punkte auf, die ein Beobachter sich im Ausdruck von Daten festhalten kann. Mehrfach beschreibt Foucault solche Gliederungen von Ereignisfolgen. Dadurch, dass Foucault als Beobachter aus dem Diskurs der Selbstverständlichkeiten aufgeklärter Vernunft und ihren festgelegten Beobachtungsperspektiven heraustritt, kann er ihr Gliederungsmuster aus der Distanz anschauen und uns verfremden. Aus dem Zirkel der aufgeklärten Vernunft, die sich selbst in ihren Maßstäben benennt und sich durch Unterscheidungen von Abweichungen von sich unterscheidet, entspringen, so möchte ich interpretierend hinzusetzen, rekonstruierbare Maßnahmen einer imaginären Verdichtung und Verschiebung, die die Symbolleistungen antreiben und motivieren.
Die imaginäre Verdichtung mündet in symbolische Konstruktionen, schließlich in eine Institutionalisierung von Kräften, die diese Bewegung praktisch umsetzen und in der Umsetzung zugleich repräsentieren können. Ich habe mit Castoriadis weiter oben bereits diskutiert, dass ein derartig konstruiertes gesellschaftliches Leben immer auch eine imaginierte Institutionalisierung voraussetzt. Die Imaginationen verwandeln sich in symbolischer Umsetzung in emotional und kognitiv gebildete Symbolik: Als Gericht und Richter, Gewalt- und Strafvollzug mittels Polizei, Normalitäts- und Gesundheitsvollzug mittels Ärzten, Militärvollzug mittels Militär und Erziehungsvollzug mittels Erziehern. In allen diesen und anderen Bereichen entspringen Hierarchien, Untertanengeist und Vernunftgründe als Beleg einer Vereinheitlichung von Sinn, von Normen und Werten einer Kultur- und Lebensgemeinschaft. Auch wenn diese Symbolvorräte niemals bruchlos oder widerspruchsfrei sind, so wird jede Raum-Zeit-Stelle ihres Erscheinens zur Aufrichtung einer Normalität, die sich im zirkulären Prozess jeweils ausschließend zu den Abweichungen verhält bzw. verhalten kann. Allenfalls Anerkennung der Andersartigkeit des Anderen konnte und kann hier eine Gegenkraft bilden.
Die imaginäre Verschiebung wird in den Praktiken dieser verdichteten und institutionell gesicherten Symbolisierungen besonders als Isolierung betrieben. Je mehr das verdichtete Netz bürgerlicher Normalität symbolisch durchgeführt funktioniert, indem es sich an sich selbst unterscheiden muss, desto mehr muss es das imaginär verschieben, was von der Normalität abweicht. Auch hier steht dann eine symbolische Umsetzung an: Asyle, Gefängnisse, Kasernen, Schulen und Fabriken erscheinen bei Foucault als solche verschobenen Orte, an denen sich die symbolische Dichte von Normalität beweist und in der sie zugleich brüchig ist.
Die Geburt der Psychiatrie ist hierbei ein exemplarischer Fall. Foucault gliedert diesen Vorgang nach epochalen Einschnitten. Gibt es im 16. Jahrhundert noch eine gewisse Unsicherheit, kritische Selbstreflexion und Offenheit im Umgang mit dem Phänomen Wahnsinn, so wird es im klassischen Zeitalter von der Mitte des 17. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts auf Isolierung hin zentriert. Mitte des 17. Jahrhunderts ist in Frankreich eine Kasernierungswelle festzustellen, die nahezu jeden hundertsten Bürger erfasst. Internierungslager und Asyle nehmen wahllos sogenannte Wahnsinnige, Kriminelle, Abweichler der Gesellschaft wie Nichtsesshafte, Arme, Exzentriker bis hin zu politischen Freigeistern auf. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts werden solche Internierungsanstalten und Asyle dann in geschlossene Anstalten mit ärztlicher Betreuung umgeformt. Die Psychiatrie entsteht als Diagnostizierung von Geisteskrankheit. Es ist ein Schwellenereignis, das mit der Kantschen Vernunft und der Entstehung der Humanwissenschaften zeitlich einhergeht. In den Praktiken der Asylierung wie auch in der Einrichtung von Irrenhäusern richtet die Vernunft sich in der Isolierung des Anderen, des Heterogenen ein. War bis zum Ende des 18. Jahrhunderts das Monsterhafte, das Wüste und Fantastische, wie es etwa bei Hieronymos Bosch erscheint, bereits Abweichung, so erscheint in der Abgeschlossenheit des Wahns nunmehr sowohl die Furcht, dass der Wahnsinn sich nach außen verbreiten könnte, als auch das Mitleid als psychische Abwehr von Betroffensein. Abweichung wird ein Konstrukt menschlicher Vernunft. Kriminelle und geistig Kranke, alle weiteren Sorten des abweichenden Verhaltens werden nunmehr geordnet, und die Ordnung ihrerseits wird organisiert, institutionalisiert. Die überwachende Isolierung entsteht als Verobjektivierung durch Wissenschaft. Es sind die „guten Gründe“, denen alle Menschen gleichermaßen ausgesetzt scheinen, es ist der Blick der Moderne, ein Panoptismus, der objektivierend eingreift und kontrollierend und prüfend das Verhalten wie eine technisch und mechanisch zu beobachtende Maschinerie zu beurteilen vermag und sich hierbei seiner Vernunft immer sicherer wird. Das analytische Zerlegen prägt diesen Blick, der alles durchdringt. Sein Wissen scheint sich nur in Beobachtung ohne direkte Teilnahme und Handlungen im Beobachtungsraum fundieren zu können – eine Sichtweise, die bis heute nicht nur für die Medizin dominierend ist. Ohne Distanz zur hier auftretenden Ordnung gedacht, ohne Kritik gegenüber den Beanspruchungen von Vernunft, die den Wahn oder das Anderssein als Gegenteil zur Erklärung des eigenen Status benutzt, wird sich solcher Blick, wird diese Sicht zu einem Monolog des Wissenden, zur Vereinsamung der Wissenschaft in ihrem Wissen, zur Spezialisierung des Monologs, zur Unüberschaubarkeit für Außenstehende und insgesamt zu einer Machtfalle. Universitäten richten sich gegenüber ihren Studenten als monologische Instanzen auf, in denen einem erst Hören und Sehen vergehen muss, um sich auf den homogenen Stand des Wissens zu bringen. Dialoge werden durch die gesetzte Komplementarität als unangemessen empfunden. Objektivität ist der Maßstab, der Subjektivität fürchtet und sich allerlei Regeln überlegt, diese auszuschließen. Aufklärung scheidet sich von jenen, die unaufgeklärt sind. Fürsorge richtet sich jenen gegenüber auf, die bedauerlicherweise anders sind, zugleich aber oft das Schuldgefühl gegenüber der Stigmatisierung des Abweichlers bei den sogenannten Fürsorglichen noch empfinden lassen. Das Sehen scheidet sich vom Gesehenwerden.
Foucault gelingt es, diese Unterscheidungen in der Zirkularität von Vernunft und Unvernunft aufzuspüren, indem er theoretische Diskurse und Praktiken gegeneinander hält und in ihrer Wechselwirkung von außen beobachtet. Die von Habermas gestellte Frage, inwieweit er damit selbst noch im Kontext der Vernunft argumentieren muss, um Konstellationen des Wechselbezuges von Vernunft und Wahnsinn zu beobachten und diese Beobachtung zu legitimieren, erscheint nur dann als Problem, wenn die eigene Beobachterposition im Blick auf die Zirkularität sich noch nicht formuliert hat. Habermas formuliert seine Kritik letztlich aus der Perspektive der kausalen Beweisnotwendigkeit einer Überlegenheit seines eigenen vernunftbetonten Ansatzes. Aus diesem Fokus kann er Grenzen bei Foucault aufweisen. Gleichwohl lässt sich umgekehrt mit Foucault der Wille nach Wahrheit bei Habermas kritisch betrachten. Doch dies gilt für eine Kritik ja immer. Was mir bei Habermas zu fehlen scheint, ist eine tiefere Einsicht in die Zirkularität und die Beobachterposition der praktischen Beziehungen, die wir mit Foucault gewinnen können. So kann Foucault in „Die Ordnung des Diskurses“ schreiben: „Der wahre Diskurs, den die Notwendigkeit seiner Form vom Begehren ablöst und von der Macht befreit, kann den Willen zur Wahrheit, der ihn durchdringt, nicht anerkennen; und der Wille zur Wahrheit, der sich uns seit langem aufzwingt, ist so beschaffen, dass die Wahrheit, die er will, gar nicht anders kann, als ihn zu verschleiern.“ (Foucault 1974, 15) Der „wahre Diskurs“ erscheint hier als ein Diskurs, der sich den je individuellen und kollektiven Ansprüchen, dem trieb- und gesellschafts- bzw. interessenbezogenen Begehren und darin entstandener und verwobener Macht entzieht, was er jedoch nicht kann. Aber welche Instanz soll dieses Nicht-Können feststellen? Hat Foucault nun seinerseits die letzte Wahrheit hinter der von ihm kritisierten (Un-)Wahrheit gefunden?
Foucault betont immer wieder, dass Wahrheit ein Ausschließungsmechanismus ist, der unmittelbar oder mittelbar mit Macht verbunden ist. Hier kann ein Wille zur Wahrheit somit jederzeit zur Verschleierung der Wahrheit führen. Unterschiedliche Konstrukteure von Wahrheiten erscheinen. Allerdings geht Foucault noch nicht so weit wie Konstruktivisten: Die Konstruktion von Wahrheiten in den Wirklichkeiten wird von ihm weder konsequent konstruktivistisch betrieben noch mit einer Beobachtertheorie verbunden. Gleichwohl aber ist implizit durchaus eine Art Konstruktivismus seinen Bestimmungen zu eigen. Die Beobachtertheorie können wir in der Interpretation hinzufügen, um so seine Analysen mit Gewinn für den interaktionistischen Konstruktivismus zu nutzen. Sehe ich es so, dann hat Foucault mit seinen Analysen einen wesentlichen Widerspruch von Beobachtung erfasst: Die Beobachtung selbst ist in der Wahrheitssuche der jeweiligen Diskurse verkörpert, die der Wille zur Wahrheit intendiert. Wie aber soll dies je den Widerspruch auflösen, der in der Setzung des Einen, der Unterscheidung von Anderen wurzelt, um sich als Unterschiedenes von Anderen zu behaupten?
Erst ein Beobachter auf einer höheren bzw. anderen Ebene zu der hier konstruierten Wahrheit wird jene Perspektive einnehmen können, die es ihm erlaubt, die Schleier zu heben. Nehmen wir an, der gehobene Schleier zeigt uns eine Struktur. Diese Struktur, die uns Foucault mehrfach als seine Lösung anbietet, steht in der Gefahr, wiederum nur Setzung eines neuen Einen zu sein. Foucault verkennt diese Gefahr, sofern er meint, dass er die reinen Praktiken durchschaut hat. Aber er sieht die Gefahr, weil er durchschaut hat, dass diese Praktiken eine Wahrheit im geforderten (herkömmlichen wissenschaftlichen) Sinne verunmöglichen. Dies liegt daran, dass alle Praktiken mit Macht verbunden sind, was eine reine Vernunftbestimmung von Wahrheit nach einer Universalisierung von Sinn mit einer strategischen Komponente versieht. Die Vernunft wird unrein. Die Wahrheit wird praktisch zur Durchsetzungsform von Macht, ebenso wie Macht von Wahrheitsansprüchen durchdrungen ist. Dies ist die praktische Struktur. Mit jeder Setzung einer Struktur ist, so füge ich hinzu, ein Anfang gesetzt, der selbst wieder zur Konstruktion einer wahren Sicht wird, zu der wiederum ein außenstehender Beobachter sich seine Entschleierung vornehmen kann. So stehen die Beobachter hintereinander oder nebeneinander, und ein Ende ist nicht abzusehen. Allein dies ist schon eine Falle, in der jeder Beobachter und alle Beobachtung stecken. Aber ist diese Falle notwendig mit Macht verbunden?
Seit Anfang der 70er Jahre verdoppelte Foucault die Beobachterperspektive: Die Archäologie des Wissens deckt jene Ausschlussregeln auf, die im zirkulären Prozess humanwissenschaftlicher Zuschreibungen die Diskurse bestimmen; die Genealogie hingegen untersucht die dazugehörigen Praktiken, sie untersucht damit, wie die Diskurse entstehen, verschwinden, sich formieren, welche variablen Geltungsbedingungen und institutionellen Wurzeln sich entdecken lassen. Die Archäologie kann gar nicht anders als in der Zirkularität ungeniert und gelehrsam zu verfahren, denn die Unschärfe des Zusammenhangs bedingt eine Offenheit der Suche selbst. Die Genealogie hingegen vermag einem „glücklichen Positivismus“ (Foucault 1974, 48) zu folgen und jene Daten zu sammeln und darzustellen, die zur Rekonstruktion erforderlich sind.
Habermas (1991 a, 292 ff.) kritisiert die Inkonsequenz dieser Zweiteilung, aber er vernachlässigt dabei, wie ich denke, auch die Bedeutung dieser Bruchstelle bei Foucault. Denken wir noch einmal an die Ausschließungsgründe der Wissenschaft in ihrem Weg der Vernunft, dann erkennen wir in den Wissenschaften selbst einen doppelten Hang, sich eine Beobachtertheorie der Wahrheit zu verstellen und damit Wahrheitsfragen grundsätzlicher zu relativieren als es der Vernunft lieb sein mag. Zunächst ist die Behauptung idealer „Wahrheit als Gesetze der Diskurse“ ein Ausschließungsgrund, der letztlich zu einer Leugnung von anderen als der je durch Ausschließung erzwungenen eigenen Beobachtungen führt. Foucault spricht hierbei von einer Eliminierung der Realität des Diskurses, die unterschiedlichste Formen in verschiedenen Zeitaltern angenommen hat (Foucault 1974, 31 ff.). Das begründende wissenschaftliche Subjekt ist hierin verwoben, es konstruiert seine Beobachtungen und unterliegt dennoch der Illusion, die Wirklichkeit bloß abzubilden. „Die Dinge murmeln bereits einen Sinn, den unsere Sprache nur noch zu heben braucht; und diese Sprache sprach uns ja immer schon von einem Sein, dessen Gerüst sie gleichsam ist.“ (Ebd., 33) An die Seite solcher konstruierter Wahrheit tritt eine universelle Vermittlung, die der Eliminierung der Realität der Diskurse dient. „Ob es sich nun um eine Philosophie des begründenden Subjekts handelt oder um eine Philosophie der ursprünglichen Erfahrung oder um eine Philosophie der universellen Vermittlung – der Diskurs ist immer nur ein Spiel: ein Spiel des Schreibens im ersten Fall, des Lesens im zweiten oder des Tausches im dritten. Und dieses Tauschen, dieses Lesen, dieses Schreiben spielen immer nur mit den Zeichen. Der Diskurs verliert so seine Realität, indem er sich der Ordnung der Signifikanten unterwirft.“ (Ebd., 34) So ist vor und neben aller Beobachtung jeweils schon Konstruiertes vorhanden, und die beobachtenden Konstruktionen selbst erzeugen Zeichen, die nicht mit dem Beobachteten identisch sind. Der Diskurs ist hierfür eine Erscheinungsform. Er lässt uns die soziokulturellen Praktiken vergessen, auf denen er sich gründet oder die er anleitet.
Auf dieser Grundlage werden bei Foucault Beobachterkonstrukte entwickelt, die vor allem das Verhältnis von Macht und Wissen in der Gesellschaft und ihrer Geschichte thematisieren. Allgemein betrachtet geht er davon aus, dass die Beziehungen und Nicht-Beziehungen, die Strategien und Praktiken der Macht, die uns durchqueren, die unsere Blickwinkel definieren und uns das Verhältnis von Macht und Wissen überhaupt konstituieren, von spezifischen Formationen des Wissens begleitet sind, die Wahrheit produzieren. Solche Wahrheit und solches Wissen stehen aber nicht für sich, sondern unterliegen ihrerseits der spezifischen Ausprägung durch Machtverhältnisse, die in ihnen erscheinen, die in den Beziehungen und Körpern wie dem Willen einer Gesellschaft entfaltet sind. Aus diesem Spannungsverhältnis heraus erscheinen im Werk Foucaults immer wieder zwei eng miteinander verflochtene Fragehorizonte: (1) Was ist Wahrheit? Und: Was ist damit verbundenes Wissen? (2) Was ist Macht? Und: Was sind damit verbundene Strategien?
Der erste Fragehorizont bezeichnet für Foucault das Problem, was insbesondere die Politik des Wahren ist. Das Problem besteht nicht darin, „Unterscheidungen herzustellen zwischen dem, was in einem Diskurs von der Wissenschaftlichkeit und von der Wahrheit, und dem, was von etwas anderem abhängt, sondern darin, historisch zu sehen, wie Wahrheitswirkungen im Inneren von Diskursen entstehen, die in sich weder wahr noch falsch sind.“ (Foucault 1978, 34) Damit geht er von einer durchaus als konstruktivistisch zu bezeichnenden Grundeinstellung aus, die sich nicht eine unabhängige Beobachterposition der Wahrheit erschließen will, sondern in historischen Zeitabschnitten nach Blickweisen und Wechselwirkungen sucht, um die Produktion und Wirkungsweisen von Wahrheit in Vermittlung mit Wissen zu erforschen. Solche Wahrheit aber wird weniger entdeckt als vielmehr durch den Beobachter Foucault erfunden, damit konstruiert, in den Perspektiven auch spezifisch verengt. Dabei ist der Beobachter Foucault nicht bloß passiver Beobachter, der möglichst distanziert seine Erfindungen vollbringt, sondern selbst eingeschlossen in das, was er konstruiert und was von Anderen bereits vorerfunden ist: Eine gewisse politische Positivität durchzieht daher seine Analysen, die nicht nur das Wissen vorhandener Diskurse als erfundener – re-konstruierter – aufscheinen lassen, sondern zugleich uns als Mächtige in diesem Prozess zeigen. Diese Mächtigkeit aber ist doppelt: Einerseits kritische Betrachtung von Macht und Wissen in ihren wechselseitigen Kombinationen, andererseits die eigene Macht einer daraus erfundenen eigenen Politik und positiven politischen Philosophie. Allerdings ist diese Positivität weder naiv noch euphorisch. Jeder Beobachter des Verhältnisses von Wissen und Macht steht vor der Aufgabe, ob und wie es überhaupt möglich ist, eine Politik der Wahrheit in seiner Zeit zu konstruieren. Dabei erscheint aus der Sicht der Struktur weniger die Veränderung des Bewusstseins des einzelnen Menschen als Problem, sondern vielmehr die Veränderung des institutionellen, des politischen, des ökonomischen Systems jener Produktion von Wahrheit, die die Formation des Wissens in ihrer Zeit bestimmt. Aus solcher Formation heraus artikuliert sich das Subjekt. Aber diese Wahrheit kann nicht von Macht befreit werden, sondern es geht darum, „die Macht der Wahrheit von den Formen gesellschaftlicher, ökonomischer und kultureller Hegemonie zu lösen, innerhalb derer sie gegenwärtig wirksam ist.“ (Ebd., 54) Hier verbindet sich der kritische Blick des Beobachters mit seinem handelnden, d.h. zugleich immer auch beobachtenden, konstruierenden Bezug zur Macht, der als Widerstand gegen jene Macht gewendet werden kann, die das Subjekt zu stark bedrängt oder bedroht.
In diesen ersten Fragenhorizont reicht insbesondere Foucaults Kritik des Panoptismus, der mit der Wende in die Moderne auftritt. In „Überwachen und Strafen“ hat Foucault mit der Idee gebrochen, dass sich in Institutionen Teilstücke eines großen Mechanismus der Macht zeigen, so dass sich aus den Stückwerken institutioneller Ausschließungen die Macht selbst definieren ließe. Nunmehr erscheint ihm die Macht als zwiespältig, als ein Ereignis unterschiedlicher Praktiken, was für ihn impliziert, dass es nicht die Praxis gibt. In dieser neuen Bescheidenheit, die einer Ernüchterung gleicht, reflektiert Foucault, dass die politischen Programme, die mit universalistischem Anspruch ein Programm der Verallgemeinerung darstellen, sich eben auch gegen das immunisieren, was ihnen selbst als Kritik zukommen muss. Die Entwicklung des Marxismus hin zum Stalinismus hatte hierfür ein nicht zu übersehendes Beispiel gesetzt. Gerade deshalb kommt es darauf an, in den Praktiken die Aspekte einer Disziplinargesellschaft zu erkennen, ohne damit zugleich aussagen zu können, was Disziplinargesellschaften für alle Zeiten und ein für alle Mal auszeichnen müsse. In „Überwachen und Strafen“ hat Foucault beschrieben, wie das Zeremoniell der Strafe gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts allmählich ins Dunkel getreten ist, was sowohl ein Verschwinden des Schauspiels als auch eine Verwandlung des Schmerzes der Opfer einschloss. Innerhalb der Disziplinargesellschaft wandelte sich die Bestrafung zu einem verborgenen Teil der Rechtssache, was unterschiedliche Folgen hatte: „Sie verlässt den Bereich der alltäglichen Wahrnehmung und tritt in den des abstrakten Bewusstseins ein; ihre Wirksamkeit erwartet man von ihrer Unausweichlichkeit, nicht von ihrer sichtbaren Intensität; die Gewissheit, bestraft zu werden, und nicht mehr das abscheuliche Theater, soll vom Verbrechen abhalten; der Abschreckungsmechanik werden andere Räder eingesetzt. Also übernimmt die Justiz nicht mehr öffentlich jene Gewaltsamkeit, die an ihre Vollstreckung geknüpft ist. Dass auch sie tötet, dass sie zuschlägt, ist nicht mehr die Verherrlichung ihrer Kraft, sondern ein Element an ihr, das sie hinnehmen muss, zu dem sie sich aber kaum bekennen mag.“ (Foucault 1992 a, 16 f.) Fremd- und Selbstzwänge werden hier miteinander kombiniert. Es ist hässlich, straffällig zu werden, aber es ist ebenso wenig ruhmvoll, strafen zu müssen (ebd.). Die Justiz trennt sich von ihrem Strafapparat, sie verschiebt die Strafe in die Bürokratie. Der Verwaltungsapparat wird ihr ausführendes Organ. Damit maskiert sich die Disziplinargesellschaft. Zugleich verändern sich auch die Beobachterpositionen. An die Stelle der bloßen Feststellung der Tat und der Feststellung des Täters rücken nunmehr Perspektiven, die die Tat selbst bestimmten Beobachterbereichen und Klassifikationen zuordnen. So fragt man nicht bloß, wer ist der Täter, sondern sucht die Tat zuzuschreiben: Wahngebilden, psychotischen Reaktionen, Augenblicken der Verwirrung, Perversionen, niedriger Habsucht, aktuellen Affekten usw. (ebd., 29). Im Blick auf die Strafe steigert sich die Beobachtung in die Versuchung, ein Verhalten des Individuums vorauszusehen und seine zukünftige Sozialisation zu planen. Es ist eine Strategie, die mit der allgemeinen Vertragstheorie zusammenhängt, nach der ein Bürger mit allen Gesetzen, die er in einer Gesellschaft angenommen hat, auch jenes Gesetz annimmt, das ihn bei Übertretungen gesellschaftlicher Normen zu bestrafen bedroht. Daraus entsteht eine Paradoxie der Beobachterpositionen: Der Kriminelle „hat den Vertrag gebrochen, ist also der Feind der gesamten Gesellschaft, beteiligt sich aber an der Bestrafung, die an ihm vollzogen wird.“ (Ebd., 114) Aus dieser Paradoxie entspringen Bedürfnisse, neue Taktiken zu definieren, „um einen Gegner zu treffen, der jetzt raffinierter, aber auch verbreiteter im gesellschaftlichen Körper ist. Es gilt, neue Techniken zu finden, um die Strafen und ihre Wirkungen dem neuen Ziel anzupassen. Es gilt, neue Prinzipien zur Regulierung, Verfeinerung und Verallgemeinerung der Strafkunst festzusetzen. Es gilt, die Ausübung dieser Kunst zu vereinheitlichen; ihre ökonomischen und politischen Kosten herabzusetzen, gleichzeitig ihre Wirksamkeit zu erhöhen und ihre Wirkungsbereiche zu vervielfachen. Es geht also um eine neue Ökonomie und um eine neue Technologie der Strafgewalt: Dies sind zweifellos die wesentlichen Gründe für die Strafrechtsreform des 18. Jahrhunderts.“ (Ebd., 113f.)
Auf dieser Grundlage, so argumentiert Elias mehr als Foucault, wird der Selbstzwang zur maßgebenden Beobachtungsperspektive, um jene Hemmzeichen zirkulieren zu lassen, „die das Verlangen nach dem Verbrechen durch die kalkulierte Furcht vor der Strafe aufhalten.“ (Ebd., 144) Eine solche Selbstzwang-Gesellschaft ist eine Straf-Gesellschaft: „An den Wegkreuzungen, in den Gärten, an den Straßen, die erneuert werden, an den Brücken, die gebaut werden, in den Werkstätten, die allen offen stehen, in den Tiefen der Bergwerke, die man besucht – tausend kleine Züchtigungstheater. Jedem Verbrechen sein Gesetz, jedem Verbrecher seine Strafe. Eine sichtbare, eine geschwätzige Strafe, die alles sagt, die erklärt, sich rechtfertigt, überzeugt: Schrifttafeln, Mützen, Anschlagzettel, Plakate, Symbole, Texte – alles wiederholt unablässlich den Codex/Code. Dekorationen, Perspektiven, optische Täuschungen vergrößern die Szene, machen sie noch furchterregender, aber auch noch deutlicher. Das Publikum meint sogar, Grausamkeiten zu sehen, die gar nicht stattfinden.“ (Ebd., 145) Dabei hat ein zwanghaftes, isolierendes und verheimlichendes, auf die Körper bezogenes Modell der Strafgewalt das repräsentative, szenische, zeichenhafte, öffentliche und kollektive Modell der Strafen verdrängt (ebd., 170). Es ist ein Disziplin-Modell, das an der Kontrolle der Tätigkeiten ansetzt, um über deren Funktionalisierung zugleich die Mächtigkeit des Strafsystems und die disziplinierende Gewalt gesellschaftlicher Fortschritte zu belegen. Disziplinierungen kehren politische Individualisierungen um, indem sie für die Normalität fast ausgeschlossen scheinen. Foucaults Analyse kommt hier zu einem überraschenden Schluss: „In einem Disziplinarregime hingegen ist die Individualisierung ‚absteigend‛: je anonymer und funktioneller die Macht wird, umso mehr werden die dieser Macht Unterworfenen individualisiert: und zwar weniger durch Zeremonien als durch Überwachungen; weniger durch Erinnerungsberichte als durch Beobachtungen; nicht durch Genealogien, die auf Ahnen verweisen, sondern durch vergleichende Messungen, die sich auf die ‚Norm‛ beziehen; weniger durch außerordentliche Taten als durch ‚Abstände‘. In einem Disziplinarsystem wird das Kind mehr individualisiert als der Erwachsene, der Kranke mehr als der Gesunde, der Wahnsinnige und der Delinquent mehr als der Normale. Es sind jedenfalls immer die ersteren, auf die unsere Zivilisation alle Individualisierungsmechanismen ansetzt; und wenn man den gesunden, normalen, gesetzestreuen Erwachsenen individualisieren will, so befragt man ihn immer danach, was er noch vom Kind in sich hat, welcher geheime Irrsinn in ihm steckt, welches tiefe Verbrechen er eigentlich begehen wollte.“ (Ebd., 248f.) Diese Normalisierungstendenzen veränderten die Beobachterperspektiven, sie brachten den Panoptismus hervor.
Den Abschnitt über den „Panoptismus“ in „Überwachen und Strafen“ leitet Foucault mit einer Beschreibung des Reglements vom Ende des 17. Jahrhunderts ein, das ergriffen wurde, wenn sich die Pest in einer Stadt ankündigte. Zunächst ist die strikte räumliche Parzellierung zu nennen: Die Schließung der Stadt, das Verbot des Verlassens, die Aufteilung in bestimmte Viertel, das Töten aller frei herumlaufenden Tiere usw. Jede Straße wird unter die beobachtende Aufsicht eines Syndikus gestellt, der zu kontrollieren hat, dass sich jeder in sein Haus einschließt. Die Not macht ein striktes Beobachten im Sinne von Disziplinierungen erforderlich. „Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurchlässigen Zellen. Jeder ist an seinen Platz gebunden. Wer sich rührt, riskiert sein Leben: Ansteckung oder Bestrafung.“ (Ebd., 251) Die Pest ist so gesehen ein Grundmodell der Disziplinierung. Gegenüber den Ausschließungsritualen, mit denen gesellschaftlich auf die Lepra geantwortet worden war, verlangte die Pest gegenüber einer massiven zweiteilenden Grenzziehung innerhalb der Gesellschaft „nach vielfältigen Trennungen, nach individualisierenden Aufteilungen, nach einer in die Tiefe gehenden Organisation der Überwachungen und der Kontrollen, nach einer Intensivierung und Verzweigung der Macht.“ (Ebd., 254) Im 19. Jahrhundert nähern sich allerdings die Disziplinierungen und Ausschließungen einander an, indem der Raum der Ausschließung, der von Bettlern, Landstreichern, Irren und Gewalttätigen bewohnt ist, durch die Machttaktik der parzellierenden Disziplin kontrolliert wird. Der beobachtende Blick der Gesellschaft fällt auf alles, was abweicht. Normalität wird damit zu einer Perspektive, die die Blickrichtungen bestimmt.
In ihrer radikalsten Form hat sich diese Perspektive als ein Panoptikon konstruiert, wie es Bentham vorschlägt. Es ist ein Gefängnisbau, der aus einem Turm in der Mitte besteht, durch dessen breite Fenster man nach außen auf ringförmig um den Turm gelagerte Gebäude blicken kann, in denen Zellen so eingerichtet sind, dass sie von der Turmseite her durchschaut werden können. Untereinander sind die Zellen durch Mauern getrennt, so dass die Isolierung der Gefangenen gewährleistet ist, der Beobachter im Turm hingegen alle Zelleninsassen wie in kleinen Theatern individualisiert ständig sichtbar halten kann. Der Sinn dieser Unternehmung liegt in einer bewussten und permanenten Sichtbarkeit des Gefangenen, einer permanenten Wirkung der Überwachung, obgleich der beobachtende Blick nur sporadisch über die Gefangenen gleiten muss.
Foucault spricht davon, dass der architektonische Apparat hier eine Maschine ist, die ein Machtverhältnis symbolisiert. In diesem Panoptikum steckt ein Schema der Beobachtung, das sich auch in vielen anderen Bereichen feststellen lässt. Es muss nicht die von Bentham konstruierte Gefängnisanlage sein, um zu erkennen, wo bei der Heilung von Kranken, der Belehrung von Schülern, der Ausschließung von Wahnsinnigen, der Beaufsichtigung von Arbeitern usw. ein ähnlich gelagertes Schema – sei es real oder imaginiert – eingesetzt wird. „Es handelt sich um einen bestimmten Typ der Einpflanzung von Körpern im Raum, der Verteilung von Individuen in ihrem Verhältnis zueinander, der hierarchischen Organisation, der Anordnung von Machtzentren und -kanälen, der Definition von Instrumenten und Interventionstaktiken der Macht – und diesen Typ kann man in den Spitälern, den Werkstätten, den Schulen und Gefängnissen zur Anwendung bringen.“ (Ebd., 264).
Wenn Foucault zu Beginn seiner Analyse des Panoptikons die verpestete Stadt als ein Modell des Ausnahmezustandes hervorgehoben hatte, um ein spezifisches Disziplinarmodell zu charakterisieren, so unterscheidet sich das panoptische Schema hiervon gewaltig: Das Panoptikon symbolisiert ein Beobachtungsverhalten, in dem es grundsätzlich um Vermehrung, um produktiven Fortschritt, um Ausdehnung von Bildung und Wachstum geht, auch um ein abstraktes Prinzip des Sehens, das als Methode der Disziplinierung wirkt. Die ausgewählte Beobachterposition, die sich analytisch im Bewusstsein eines wahren Sehens weiß, die sich ihre Konstruktion von Wirklichkeit so schafft, dass sie den unterstellten sozialen Mechanismus selbst durchschauen kann, beansprucht einen Turm des wahren Sehens, von dem aus sie die Disziplinarmechanismen vollständig in die Gesellschaft hineinkonstruieren kann. Da, wo in der Pest die Disziplin noch dazu diente, eine Blockade zu errichten, eine totale Ausschließung zu veranlassen, die ein Übel auf Zeit bannen sollte, da wird im panoptischen Schema die Disziplin zu einem Mechanismus, der die Produktivität verbessern, die Macht verstärken und differenzieren, die Überwachung individualisieren soll. Dies ist für Foucault der Übergang in die Disziplinargesellschaft. Zu ihr gehören folgende Aspekte:
(1) Eine Funktionsumkehr bei den Disziplinen, die die Disziplinen des wahren Sehens nicht mehr nur auf Ausschließung, sondern auf ein positives Wissen, eine mögliche Nützlichkeit hin verpflichten. Militärdisziplin, Arbeitsdisziplin, erzieherische Disziplinen wechseln so von der Fremdzwangseite auf die Selbstzwangseite: Sie dienen nicht der Begrenzung eines unvermeidlichen Schadens, sondern werden zu Techniken, „welche nutzbringende Individuen fabrizieren.“ (Ebd., 271)
(2) Die Ausweitung der Disziplinarmechanismen führt zu einer Vervielfältigung von Disziplinarinstitutionen und -situationen. Disziplinen werden nicht nur in bestimmten Institutionen herangebildet, sondern von diesen in alle Teile des gesellschaftlichen Körpers getragen. So ist es nicht nur die Aufgabe der Schule, gelehrige Schüler heranzuziehen, sondern zugleich die Eltern dahingehend zu erforschen und zu belehren, inwieweit sie dieser disziplinierenden Rolle gerecht werden. Es beginnt ein systemisches Wechselspiel der Disziplinierungen, wobei es einem Beobachter schwerfällt, noch zu erkennen, von welcher Seite ursprünglich der Ansatz der Disziplinierung ausgeht. Es gehört geradezu zum Wesen der Disziplinargesellschaft, solche Ursprünge unsichtbar und die Generalisierung der Disziplinierung naturgemäß zu machen. Was in der Schulgeschichte als ein Fortschritt aussehen mag, nämlich die Erforschung der sozialen Umstände, unter denen Schüler produziert werden, etwa symbolisiert in der progressiven Pädagogik von Diesterweg, das erscheint aus dem Blickwinkel der Disziplinen als ein Mechanismus zunehmender Kontrolle. Gerade hierin zeigt sich aber auch, dass die Disziplinen nicht einfach abgeschafft werden können. Ihnen wohnen positive wie negative Praktiken inne, die durch die beobachtende Perspektive und die beanspruchte Wahrheit des Blickes definiert werden.
(3) Die Verstaatlichung der Disziplinarmechanismen nimmt zu, wobei der Staat immer mehr Aufgaben von privaten Gruppen in der Disziplinierung der Bevölkerung übernimmt. Die Entwicklung der Polizei, die Verstaatlichung des Schulwesens, die staatlichen Ein- und Übergriffe auf alle Institutionen des gesellschaftlichen Lebens führen zu einer Vervielfältigung staatlicher Macht.
In der Disziplinargesellschaft wird der Panoptismus der Beobachterstandpunkte aus der Sicht eines Turmes der Wahrheit, der alles durchschaut – nur sich selbst nicht in seiner Architektur –, zum Maßstab für Machtverteilungen. Dieser erscheint in historischen Prozessen, die Foucault nach ökonomischen, rechtlich-politischen und wissenschaftlichen Perspektiven unterscheidet. Die Disziplinen sind hierbei Techniken der Ordnung menschlicher Verhaltensmöglichkeiten und Notwendigkeiten, die eine Machttaktik zu definieren versuchen, die möglichst geringe Kosten verursacht, politisch unauffällig ist und deren gesellschaftliche Wirkung möglichst intensiv und extensiv sein soll (vgl. ebd., 280). In den Disziplinen findet die Macht ihren Mikrobereich, eine Art Unterbau der Kräfte und Körper, der in der Vervielfältigung wurzelt und nicht so sehr auf einen Schlag die Macht eines Souveräns demonstrieren soll. Dabei hat die bürgerliche Gesellschaft jedoch kaum ein Bewusstsein über die Zunahme ihrer Disziplinarmethoden entwickelt, zumindest kein Bewusstsein, das den technischen Erfindungen des Industriezeitalters gleichkommen könnte. Es gibt keine Feier der zunehmenden Disziplinartechniken wie bei der Dampfmaschine, den Hochöfen, der Elektrifizierung usw. „Und doch hatte man mit dem Panoptikon die abstrakte Formel einer sehr wirklichen Technologie: der Technologie der Individuen. Dass man wenig Lobreden darauf verwandte, hat seine Gründe; der offensichtlichste Grund ist der, dass die vom Panoptikon eröffneten Diskurse dieser Technologie außer für akademische Klassifikationen nur selten den Status von Wissenschaften erreicht haben; der entscheidendste Grund aber ist wohl der, dass die von ihr eingesetzte und gesteigerte Macht eine unmittelbare und physische Macht ist, welche die Menschen gegeneinander ausüben.“ (Ebd., 288)
Diese Analysen zeigen deutlich – und dies betrifft den weiter oben herausgestellten zweiten Fragenhorizont –, dass die Problematik der Macht von Foucault aus der negativen Zuschreibung einer bloßen Unterdrückungsthese herausgeführt wird. Macht kann nicht begriffen werden, wenn sie allein als eine Instanz gesehen wird, die der Unterdrückung dient und deren negative Seiten damit denunziert werden müssten. In jeder Denunziation erscheint schon wieder Macht. Machtfreiheit erscheint als eine Utopie, die die konkreten Machtpraktiken verschleiert. Gerade die marxistische Wende in der Politik kann hier herangezogen werden: Hinter der Parole einer herrschaftsfreien Gesellschaft verbirgt sich eine Diktatur des Augenblicks, dessen Länge angesichts von Machtpraktiken nicht festgesetzt werden kann. Insofern es aber kein Zeitkriterium gibt, lässt sich die Macht auch nicht begrenzen und noch nicht einmal als beseitigungsfähig definieren. An die Stelle der Träume, der Illusionen, der Hoffnungen gegenüber der Macht sollte daher nach Foucault die konkrete Analyse gängiger Praktiken rücken. Im Blick auf die Repressionsthese bezweifelt Foucault in mehrfacher Weise gängige Unterdrückungstheorien (vgl. auch Balibar 1991, 42):
- die These einer wechselseitigen Implikation der Unterdrückung des Sexus und der Ausbeutung der Arbeitskräfte im Kapitalismus und die mit ihr verbundene Utopie einer groß angelegten sexuellen Befreiung als wesentlicher Komponente der politischen und sozialen Revolution, weil dies übersieht, dass die Sexualität ihren eigenen Diskurs innerhalb der gesellschaftlichen Machtpraktiken führt, mithin auch innerhalb jener Bewegung, die die Befreiung intendiert;
- die These von einer Komplizenschaft zwischen der Polizei der Aussagen, der moralischen Zensur und der Reproduktion der ökonomischen Verhältnisse unter der Herrschaft einer politischen Ordnung, die leicht vergessen macht, dass Machtpraktiken alle sozialen Körper durchdringen, so dass insbesondere die Befreiungsbewegungen die Strategien der Macht durchschauen lernen müssen, um ihnen nicht blind selbst zu erliegen;
- die These von der Mechanik einer Durchquerung der bürgerlichen Ordnung vom Allgemeinen zum Konkreten, d.h. die These der Disziplinarmächte, die sich in konkreten Situationen manifestieren, indem sie von den allgemeinen Institutionen in die familialen und edukativen Autoritäten hinabreichen, was allerdings dadurch relativiert wird, dass dieses Durchqueren in alle Richtungen geschieht;
- die These von einer natürlichen Energie, die aus psychoanalytischer Sicht auf einer Suche nach Lust basiert und die gerne den künstlichen Institutionen, von individuellen Tabus bis hin zum Staat, entgegengesetzt wird, worauf sich die These der Repression gründet, ohne darin jedoch eine monokausale Begründung für alle Zeiten finden zu können.
Foucaults Analysen belegen trotz dieser Einschränkungen, die eine systemische Sichtweise für ihn eröffnet, die Repression in all diesen Feldern mit eindrucksvollen Beispielen, die oft auch nahe zu Aussagen von Marx oder Freud stehen. Foucault bestreitet nicht die Wichtigkeit des Kampfes gegen Repressionen, aber ihm stellt sich die entscheidende Frage, inwieweit die Kämpfer gegen die Repression in ihren Diskursen tatsächlich mit den Ordnungen brechen, die sie denunzieren. Dies schließt eine doppelte Kritik ein: Einerseits jene Machtpraktiken und strategischen Kämpfe aufzudecken, in denen Institutionen der Macht, der Normalisierung auftreten und eine Disziplinargesellschaft erscheint, andererseits aber auch im Diskurs der Macht jenen Mechanismen der Macht nachzuspüren, die den Diskurs des Kämpfers gegen die Macht durchdringen. Dabei hat Foucault weder in seinen theoretischen Werken noch in seinem praktischen Einsatz für unterdrückte Menschen einen Weg beschreiben können noch wollen, der in eine letztlich glückliche machtfreie Utopie führen könnte. In seiner Sicht, die hier überwiegend entsubjektivierend ist, zeigt sich der Diskurs als immer schon verallgemeinertes Ganzes, das auf zirkuläre Weise die Ereignisse der Macht durchdringt. Aber eben deshalb ist es umso wichtiger, ständig auf ihn hin zu reflektieren, um im Eingewobensein jene Distanz zu bewahren, die Kritik erst ermöglicht.
In den Studien über „Sexualität und Wahrheit“ hat sich diese Sicht von Foucault verschärft. Im ersten Band (der „Wille zum Wissen“) geht die Kritik der Repressionshypothese mit der Darstellung der Funktion, über den Sex zu sprechen, einher. In dem Maße nämlich, wie sexuelle Tabus in der bürgerlichen Gesellschaft errichtet wurden, wurde es gleichzeitig notwendig, über diese vermeintliche Wahrheit zu sprechen, um sie als jedermanns Wahrheit zu produzieren. „Ein Gebot, welches das Wuchern der in Betracht kommenden Diskurse sichert (welches die modernen Gesellschaften des Westens wahrscheinlich zu den geschwätzigsten Gesellschaften der Geschichte des Sexes und zu den Erfindern dieses Gattungsbegriffs macht), und welches durch die Vorstellung des Verbotes nicht vermindert, sondern im Gegenteil noch taktisch verstärkt wird.“ (Balibar 1991, 45)
Aus dieser Sicht entwirft Foucault drei entscheidende Argumente gegen die Repressionshypothese, die sowohl die psychoanalytischen Kritiken als auch den Marxismus relativieren (vgl. ebd.):
Erstens erscheint es Foucault als historisch falsch, dass die seit dem 18. Jahrhundert sich entfaltende Gesellschaft den Sex in ihren Diskursen verweigert hätte. Sie hat ihn vielmehr als Gegenstand ständiger Bemühungen hervorgebracht und damit zugleich die heutige vermeintliche Enttabuisierung mit hergestellt. Foucault bestreitet auch, dass die entstehende proletarische Massenarbeit zur Überwachung des Sexes der Arbeiter führte, um ihr Leistungspotenzial zu steigern. Ihm erscheint es umgekehrt als viel plausibler, dass das Dispositiv des Sexes im Sinne der Einhaltung von Sitten innerhalb von Familien, vorrangig des Inzestverbots, der Disziplinierung durch Erziehung, durch Maßnahmen der Medizinierung und Psychiatrisierung dieser Ideen in die Arbeitswelt importiert wurden, statt von dieser exportiert zu werden. Ein Dispositiv bezeichnet bei Foucault ein Durcheinander, ein Ungleichgewicht von Kräftelinien und Richtungsänderungen, von Verzweigungen und Abweichungen, die besonders in Krisen durch Bruch- und Spaltungslinien erkennbar und bezeichenbar werden. Der Kartograf versucht eine Landkarte solcher Linien herzustellen, eine „Arbeit im Gelände“ zu leisten, um die Wirkungen des Dispositivs zu beschreiben. „Die Dispositive sind .. zusammengesetzt aus Sichtbarkeitslinien, Linien des Aussagens, Kräftelinien, Subjektivierungslinien, Riss-, Spalt- und Bruchlinien, die sich alle überkreuzen und vermischen und von denen die einen die anderen wiedergeben oder durch Variationen oder sogar durch Mutationen in der Verkettung wieder andere erzeugen. Daraus ergeben sich zwei wesentliche Folgerungen für eine Philosophie der Dispositive. Die erste ist die Zurückweisung der Universalien ... Die zweite Konsequenz ... besteht in einer Änderung der Orientierung – diese wendet sich vom Ewigen ab, um das Neue aufzunehmen. Das Neue ist nicht dazu bestimmt, die Mode, sondern vielmehr die den Dispositiven folgende variable Kreativität zu bezeichnen“. (Deleuze 1991, 157f.)
Zweitens erscheint für Foucault die Macht nicht nur als Herrschaftsmacht, die Gehorsam produziert, sondern auch in einem positiven und produktiven Sinne, weil – in einer zirkulären Betrachtung – es immer auch eine Kehrseite von Macht geben mag, die für Systeme Entwicklung und Veränderung bedeuten kann. In diesem Sinne hatte Foucault bereits in „Wahnsinn und Gesellschaft“ über den positiven Sinn der Internierungsmacht gesprochen oder Wirkungen einer Genealogie der Affirmationsmacht in „Die Ordnung des Diskurses“ beschrieben.
Drittens bestreitet Foucault eine leichtfertige Gleichstellung von allgemeinen und spezifischen Strukturen, wie sie im Verhältnis von Familie und Staat erscheinen. Die Familie ist zwar auch im Dispositiv der Regulierung der Bevölkerungen ein Aspekt der Macht des Staates, aber sie differenziert sich bei Foucault in unterschiedliche weitere Aspekte: Sie ist der Ort institutioneller Perversionen, der Hysterisierung des Körpers der Frau, das andere des psychiatrischen Raumes, der Ort der Konkurrenz verschiedener Wissenschaften über den Menschen, ein Instrument der Sozialisierung von Fortpflanzungsverhalten, insbesondere aber ein Ort der juridischen Wiederherstellung allgemeiner körperlicher Techniken in den Formen der Gemeinschaftsbindung und Verwandtschaft. So gesehen ist sie weder eine Monade noch ein Teil, der für ein Ganzes steht; sie ist keine bloße Reproduktionsinstanz der Gesellschaft, ebenso wenig wie diese sie selbst imitiert. Foucault macht darauf aufmerksam, dass das System Familie ein eigenes System ist, das zwar in seinen Wechselwirkungen zu anderen beschrieben werden kann, das sich jedoch nicht auf einfache schematische Gleichungen reduzieren lässt. Damit entwickelt Foucault eine theoretische Haltung, die auch für konstruktivistische Bemühungen richtungsweisend ist. Insofern das Feld Familie in den beobachtenden Fokus genommen wird, zeichnet sich ein Bild, das nach den Rändern hin verschwommen ist. Insofern wir uns diesen verschwommenen Rändern zuwenden, den Übergängen, den Verallgemeinerungen, die in ihnen stecken, rekonstruieren wir immer noch das, was Familie ist, überschreiten aber auch mit Notwendigkeit diese, um uns einem neuen Beobachtungsbereich zuzuwenden. Alle diese Beobachtungsbereiche sind letztlich unser Konstrukt. Aber diese Konstrukte zwingen uns zugleich, über die Schärfe der Beobachtungen selbst nachzudenken.
Da Foucault diese Rekonstruktion nicht immer explizit macht, ist es für die Rezipienten seiner Theorie allerdings schwer, die jeweilige Blickrichtung, die er intendiert, auszumachen. Da er hierbei weder die Zirkularität seiner Sichtweise noch die spezifische Problematik der Unschärfe für unterschiedliche Beobachtungswirklichkeiten, insbesondere nicht für die Beobachtung von Dingen oder dinghaft gefassten Personen, und Beziehungswirklichkeiten systematisch thematisiert, erscheint eine sprunghafte Methode im Blick auf die Verhältnisse bei ihm als unvermeidlich. Aber gerade wegen dieser Sprunghaftigkeit im Denken und im Beobachten sollten wir Foucault sehr schätzen, da er lieb gewordene Gefangenschaften durch die Rückfrage auf den Diskurs, den sie vermeintlich kritisieren, zu entdecken versteht. Dies ist zwar ein Verfahren, das uns vielfach überfordert, aber es steht den Perspektiven der Beziehungswirklichkeit dahin gehend nahe, dass es sich auf die Unschärfe einlässt, die wir mit dem Diskurs über die Unschärfe vielleicht schon wieder eliminieren wollen.
Eine konstruktivistische Beobachtertheorie findet bedeutsame Anregungen allein schon durch diese Grundkonstellation von Beobachtung, Konstruktivität und Widerstand bei Foucault. Dabei mag es allerdings durchaus streitbar erscheinen, inwieweit das Problem von Wissen und Wahrheit immer vorrangig im Blick auf Macht zu diskutieren sein wird.
Thomas McCarthy wendet gegen Foucault insbesondere ein, dass seine Kritik der Macht allein im Blick auf zu große, hegemoniale Macht einseitig ausfällt (1993, 76). Diese Position, die von Habermas inspiriert ist, findet es sehr unbefriedigend, dass wir einerseits stets in all unseren Beziehungen von Macht durchquert sind, andererseits aber dann gegen Auswüchse solcher Macht ankämpfen sollen. Das von Foucault aufgeworfene Problem erscheint in der Tat als unscharf. McCarthy wendet unter anderem ein,
- dass Foucault einerseits gegen Ontologieansprüche der Vernunft vorgehe, andererseits aber sich selbst oft auf eine Ontologie des Gesellschaftlichen (der Macht) berufe (ebd., 78);
- dass bei ihm der Machtbegriff zu unscharf geworden sei, weil er nicht hinreichend von Zwang, Autorität, Gewalt, Herrschaft, Legitimation usw. unterschieden werde (ebd., 79, 81);
- dass bei ihm zu sehr unscharfe Begriffe wie Regime, Netze, Dispositiv usw. im Vordergrund stehen (ebd., 82), und dass er es vermeide, konkrete Sozialisationstheorien als relevanten Bezugsrahmen zu analysieren (ebd., 83); damit verfehle er auch eine zureichende Erklärung der gesellschaftlichen Integration (ebd., 84);
- dass er die Relevanz des subjektiven Teilnehmers herunterspiele (ebd., 83 f.);
- dass Foucault zu wenig kapitalismuskritisch erkenne, wo der Kapitalismus die Ausgewogenheit einer Rationalität verfehle, die für das moderne Weltverständnis wesentlich sei (ebd., 76);
- dass seine Begriffe besonders unklar werden, wenn er sich auf Antriebe, das Begehren – etwa „den Körper und seine Lüste“ – beziehe (ebd., 86).
Obgleich einzelne Aspekte dieser Kritik anregend sind, so scheint sie mir zu vereinfachend zu sein. Sie ist aber zugleich instruktiv, weil sie einmal mehr auf Mängel des von McCarthy und Habermas vertretenen Konzeptes aufmerksam macht. Gehen wir sie nacheinander durch:
- Je mehr sich Foucault auf soziokulturelle Praktiken bezieht, umso stärker wird eine Ontologisierung unterlaufen; Foucault selbst reflektiert dies, indem er Struktur als Vorgängigkeit und Ereignis als Singularität markiert. Der interaktionistische Konstruktivismus setzt hier klarer als Foucault auf eine explizite Beobachtertheorie. Sie begründet sich nicht ontologisch, sondern als ein Beobachterkonzept einer Verständigungsgemeinschaft mit spezifischen Interessen (in einer Pluralität) und stets nur auf Zeit.
- Foucault zu unterstellen, dass sein Machtbegriff zu unscharf wird, vernachlässigt seine konkreten Studien im Umkreis der Macht, die sich durch eine hohe Differenzierung des Gegenstandes auszeichnen. Das Dispositiv der Macht ist für Foucault ein vielfältig zusammengesetztes, und in seinen Analysen beschreibt er diese Vielfalt an ausgewählten Analysegegenständen. Die Kritik von McCarthy, dass er hierbei die Macht nicht hinreichend differenziere, halte ich für überzogen und auch für unbegründet. Sie meint auch etwas anderes: Macht wird von Habermas-Anhängern nicht so gern als ein durchgängiges Prinzip von sozialen Verhältnissen gesehen, weil dies offenbar der eigenen Erkenntnisbegründung zuwiderläuft. Was diese Kritik ihrerseits aber ausspart, das ist eine konkrete Analyse jener Machtverhältnisse auch für den Kritiker, die Foucault am Beispiel sozialer Praktiken differenziert schildert. Andererseits gibt der Kritiker hier die meisten Analysen von Foucault als durchaus zutreffend zu (ebd., 80). Handelt es sich nur um ein terminologisches Problem, um ein Missverständnis, was die Beobachterbereiche und die Modi der Beobachtung betrifft? Der interaktionistische Konstruktivismus versucht durch seine Beobachterbereiche verständlich zu machen, was die Kritik beunruhigt: Im engen Beobachterbereich gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen von Macht, die eindeutig und möglichst scharf bezeichnet werden. Demgegenüber scheint bei Foucault alles in einer Macht (allerdings als Dispositiv, d.h. als eine Zusammenfassung sehr unterschiedlicher Kräfte und Ereignisse) zusammenzufallen. Dies liegt darin, dass Foucault im Blick auf die sozialen Praktiken vielfach in den Beobachterbereich der Beziehungen der Menschen wechselt. Hier atmet, wie wir durch die Psychologik erfahren haben, eine ganz andere Unschärfe als im Bereich der engeren Beobachtungen der traditionellen Wissenschaften. Deshalb will Foucault eine Anti-Wissenschaft. Unter Bezug auf die Beziehungswirklichkeit und ihre Praktiken aber kann kein Vorgang frei von der Mächtigkeit der Akteure und damit verbundener Macht in ihren Wechselverhältnissen gedacht werden. Dies teilt der interaktionistische Konstruktivismus mit Foucault. Allein schon im Spiegelungsvorgang erkennen wir eine Mächtigkeit des Selbstbeobachters, die in ihren Wirkungen auf a/Andere nie machtfrei sein kann: Sie imaginiert den anderen bloß als eigenes Wunschbild; sie unterlegt den Anderen in realer Wechselwirkung stets die eigenen Ansprüche und Kontexte dieser Wechselwirkung (und hierbei ist Macht ein immer beobachtbares Phänomen). Genau zu diesen Aspekten aber hat die Habermas-Schule keinen hinreichenden Zugang gefunden.
- Die Kritik an zu allgemeinen Begriffen als Abstraktionen von der konkreten Lebenswelt wird man an jeder Theorie üben können. Die Konzentration auf Sozialisationstheorien hingegen ist ein Moment der Anpassung an vorgängige symbolische Leistungen, die zeigt, wie konservativ jede Theorie dann wird, wenn sie die Rekonstruktion gegenüber einer Dekonstruktion von Lernkonzepten bevorzugt (vgl. Kapitel III.2.4). Gesellschaftliche Integration ist ja auch nur ein Blickwinkel, der uns oft verdeckt, wo diese Integration ihr Ziel verfehlt. Diese Zielverfehlungen aber werden in der Gegenwart immer vordringlicher, wenn man kritische gesellschaftliche Analysen betreiben will. Nimmt man Habermas Aussagen zur Sozialisation, so rekonstruiert er oft treffend die Leistungen eines symbolischen Aneignungssystems, aber er kritisiert zu wenig deren Inhalte und Formen. Für Foucault reicht es nicht aus, die Aspekte einer gelingenden Sozialisation idealtypisch zu beschreiben, er dekonstruiert deren Gewohnheiten als ein durch Macht subvertiertes System. Damit markiert er Auslassungen im idealtypischen Sozialisationsmodell von Habermas, das dieser ja leider kaum weitreichend bis in eine konkrete Praxis bzw. konkrete Praktiken im Sinne einer Archäologie wie bei Foucault verfolgt hat. Der interaktionistische Konstruktivismus hält hier ein offeneres Konzept für unumgänglich: Rekonstruktion von Sozialisation (allerdings in ihren Widersprüchlichkeiten unterschiedlicher Beobachterkonzepte) als Notwendigkeit, um als Beobachter ein Modell von Strukturen der Lebenswelt zu entwickeln, das Anpassungsmuster als Ordnung in ihrer Entwicklung – also Teilnahmebedingungen und Akteurseigenschaften – aufweist. Dekonstruktion als Notwendigkeit, um hierin gerade unsere Gewohnheiten und erwünschten Bilder aufzubrechen und gegen sich selbst zu kehren. Foucault dekonstruiert zutreffend die rekonstruktiven Erwartungen von Habermas, weil er jede Vernunft als strategisch – von Macht subvertiert – ausweist (vgl. dazu weiterführend auch meine Kritik an Habermas in Kapitel IV.3.3.2.2).
- Schließlich aber vor allem Konstruktion als Notwendigkeit, mittels eigener Beispiele das eigene Beobachter- und Denkmodell umzusetzen. Dieser Punkt ist schwierig, denn er bedeutet einen Übergang von einer Theorie der Erklärung oder der Kritik in eine der Tat. Deshalb ist es für den interaktionistischen Konstruktivismus wesentlich, rekonstruierte Sozialisationsvorgänge nicht nur verständlich zu machen, sondern zu verändern (vgl. Reich 2005, 2008).
- Die Relevanz des subjektiven Teilnehmers wird sowohl bei Foucault als auch bei Habermas unterschätzt. Aufgrund der Analysen soziokultureller Praktiken tauchen die Teilnehmer aber meines Erachtens bei Foucault stärker als bei Habermas auf, auch wenn sie als idealtypischer Reflexionsgegenstand bei Habermas oft zum Ausgangspunkt einer Argumentation genommen werden. Beide Ansätze aber verfügen nicht über eine Theorie der Beziehungswirklichkeit, die diese als neuen Beobachtungsraum, der sich mit der wissenschaftlichen Beobachtungswelt und der Lebenswelt durchmischt, erläutern lässt. Für den interaktionistischen Konstruktivismus ist jeder Beobachter als subjektiver Teilnehmer relevant. Aber ich bin nicht so naiv zu behaupten, dass diese Relevanz als subjektive Mächtigkeit auch ungebrochen zu einer gesellschaftlichen Macht wird. Im Gegenteil: Foucaults Analysen zeigen uns ja gerade, wie sehr gewohnte Machtprozesse die subjektiven Teilnahmen beschränken, wenngleich sie diese zu einem Teil voraussetzen.
- Die Kapitalismuskritik kann viele Gesichter tragen. Ein Gesicht, auf das McCarthy im Sinne von Habermas abhebt, ist, dass in nachkantianischer Fassung die Selbstideale der bürgerlichen Gesellschaft mit den Defiziten konfrontiert werden, die zu einer Verfehlung von möglicher Rationalität führen. Wenn Foucault sagt, dass für ihn die Suche nach einer Moral, die für jeden akzeptabel ist, als katastrophal erscheint, so muss dies McCarthy abwehren, weil es zumindest formal noch so etwas wie eine Gerechtigkeit geben soll, an der sich eine Rationalität ethischer Klugheit zu orientieren habe (McCarthy 1993, 109). Was aber soll diese formale Restgröße sein? „Wenn es um Fragen der Gerechtigkeit geht, ist eine faire und unvoreingenommene Betrachtung der widerstreitenden Interessen erforderlich, während dann, wenn sich Wertfragen stellen, Erwägungen darüber, wer man ist und wer man sein möchte, im Mittelpunkt stehen.“ (Ebd., 109 f.) Anders gesprochen will Habermas wie auch Kant nicht Fragen des persönlichen Lebens – der Beziehungen – im Blick auf ein gutes Leben, auf Selbstverwirklichung usw. zum Ausgangspunkt einer universalen Moral nehmen, sondern „nur“ Angelegenheiten der Gerechtigkeit. Seine Theorie der Gerechtigkeit versucht daher gesellschaftliche (objektive, soziale, subjektive) Vorbedingungen zu rekonstruieren, von denen aus konkurrierende Interessen, Wahrnehmungen, Widersprüche usw. fair beurteilt werden können. Für Foucault zeigen die soziokulturellen Praktiken jedoch die Unmöglichkeit dieses Ansinnens. Gewiss gesteht auch Foucault zu, dass es relativ faire Argumentationen geben kann und sollte, aber sie erscheinen eher als Ausnahme und vor allem dann, wenn die individuelle Selbstverwirklichung als Status, als Habitus des Intellektuellen dies überhaupt vor seinem Macht- und Interessenhintergrund ermöglicht. Dies ist auch die Sicht von Bourdieu, wie ich weiter oben hervorgehoben habe. Im Grunde ist jede faire Handlung durch Macht subvertiert, weil schon jedes Wissen und alle Wahrheit subvertiert sind. Die konkrete Analyse zeigt immer erst die reale Subversion, die sonst in einer abstrakten Verallgemeinerung über allgemeine Gerechtigkeitsrekonstruktionen, die idealtypische Hoffnungen auf eine faire Lösung beinhaltet, verschwinden. Der interaktionistische Konstruktivismus sieht beide Seiten, aber er möchte sie schärfer fassen: Im Sinne Foucaults trägt unsere Analyse der Beziehungswirklichkeit dazu bei, überall eine Mächtigkeit des Subjekts als vorgängige Voraussetzung zu denken, die durch das Begehren und Spiegelungen von Anerkennungen nie frei von Macht sein kann. Solche Macht trägt sehr unterschiedliche Züge als Zwang, Autorität, Anerkennungsstreben, Selbstbehauptungspotenzial, Legitimation, Rechtfertigung usw. Aufgrund der Verwobenheit von Beziehungen und wissenschaftlichen Beobachtungen können wir unvoreingenommene Beobachtungen nicht mehr erwarten. Wir verlieren so auch die Hoffnung auf universal begründete, als gerecht rekonstruierte Handlungen. Aber dies betrifft nur eine rekonstruierte Herleitung und Legitimation, keineswegs unser konstruktives Vermögen. Aufgrund bestimmter Einsichten, sofern diese sich mit unseren Interessen- und Machtvorstellungen verbinden, so kann man dies wenden, sind wir durchaus im Rahmen bestimmter Verständigungsgemeinschaften in der Lage, möglichst fair die Umstände und Verhältnisse zu untersuchen. Dabei benötigen wir Dekonstruktivisten, die uns in unserer harmonisierenden Ordnungssuche verstören, aber wir benötigen auch Konstruktivisten, die nicht bloß das Rekonstruktive als Ideal entfalten, sondern neue Handlungen und Lösungen ermöglichen. Eine Unterscheidung von wissenschaftlichen – engeren – Beobachtungen und Beobachtungen der Beziehungswirklichkeit erleben wir hierbei in unserem Alltag. Aber diese Unterscheidung darf nicht zu einer Spaltung wie bei Habermas führen. Hier stehe ich auf der Seite von Foucault: Die Wertfragen der Beziehungen (oder der Alltag der Lebenswelt) subvertieren nämlich alle Rekonstrukte der Gerechtigkeit. Erwägungen darüber, wer man ist oder wer man sein möchte, gehen jeder Frage nach Gerechtigkeit voraus. Dies liegt im Wesen des Imaginären, der Spiegelungen, der Suche nach Anerkennung, die bereits das Verhältnis unserer Gefühle zu unseren Kognitionen charakterisiert, wie ich hervorgehoben habe. Nur ein verengender kognitivistischer Ansatz kann überhaupt der Illusion verfallen, hier eine Spaltung erfolgreich durchführen zu können.
- Die Unschärfe, die wir uns damit einhandeln, gebe ich unumwunden zu. Bei Foucault führt dies zur Anerkennung singulärer Ereignisse, die alles strukturelle Denken subvertieren. Im interaktionistischen Konstruktivismus sehe ich deshalb die Unschärfe des Beobachtens und der Erkenntnis als Ausgangspunkt der hier vorgelegten Analysen an. Die Unschärfen befreien uns vor Übererwartungen. Aber sie machen auch den Weg frei, praktische Lösungen in ihrer Vielfalt und nicht vorrangig unter der Erwartung von vorgeordneten Theoriegesichtspunkten zu sehen. Der symbolische Druck, in unser Blicken doch wieder eine Ordnung einzuführen und durchzusetzen, ist ohnehin groß genug.
Abschließend bleibt die Frage, ob die Macht damit das zentrale Beobachterproblem darstellt, das wir zu bearbeiten haben, wenn wir uns der Lebenswelt zuwenden. Oder gibt es noch andere Beobachterperspektiven?
Der späte Foucault hat aus dem Gesichtspunkt der Macht von Techniken gesprochen, die wir im Blick auf (1) die Produktion, (2) den Zeichengebrauch (Sprache), (3) die Herrschaft und (4) das Selbst einsetzen. Diese Techniken, auch als Technologien oder Relationen von Foucault bezeichnet, erscheinen im zweiten Band von „Sexualität und Wahrheit“ unter den Perspektiven „Felder des Wissens“, „Typen der Normativität“ und „Formen der Subjektivität“. Foucault nimmt hierbei eine Wende vor, die dem Anliegen des interaktionistischen Konstruktivismus, die Beziehungen im Blick auf Wissen und Normativität stärker zur Geltung zu bringen, durchaus nahekommt. In der Schrift „Das Subjekt und die Macht“ (Dreyfus/Rabinow 1994) bestimmt Foucault die Macht als „Wirkungsweise gewisser Handlungen, die andere verändern“. Hier tritt die Beziehungsebene klar in den Vordergrund. Seine Analyse unterscheidet sich von meiner dadurch, dass er nur auf die symbolische Seite abhebt, aber für diese klar die Position der Mächtigkeit des Subjekts und der Wirkung der Macht bestimmt. Macht in Beziehungen ist der Versuch, das Verhalten des Anderen zu lenken, es zu beeinflussen. Auf der Beziehungsebene sind solche Machtverhältnisse beweglich, umkehrbar, instabil. Aber in der Perspektive auf die Lebenswelt und die ökonomischen und institutionellen Verhältnisse erleben wir solche Macht auch als Herrschaft, die sie zu festen, unumkehrbar erscheinenden, stabilen und asymmetrischen Mustern ausgeformt hat, die unseren subjektiven Spielraum begrenzen. Subjektiv versuchen wir, die Welt nach eigenen Maßstäben zu erfinden, aber schon diese Mächtigkeit untergräbt die Vorstellungen und Handlungen unserer Mitmenschen. Zwar unterscheidet Foucault noch nicht systematisch das systemische Wechselspiel der Beziehungswirklichkeit, aber er deutet an, dass hier alle Handlungen in die Versuche sowohl des subjektiven Begehrens als auch symbolischer Bemächtigung eingebunden sind. Auch wenn uns hier Verständigungsgemeinschaften zur Seite stehen, so können wir bei keinem Konsens, bei keinem Geltungsanspruch erwarten – weder, was die Wahrheit noch was die Wahrhaftigkeit oder Richtigkeit von Ansprüchen betrifft –, dass sie nicht irgendwie Instrumente von Machtausübung sind. Dies liegt an der kommunikativen Struktur, weil jede symbolische Information des einen Kommunikationspartners bereits Wirkungen von Macht eines anderen herbeiführt.
In den „Technologien des Selbst“ akzentuiert dies Foucault (1993 b) sehr stark im Blick auf die Integration von Zwangstechnologien und Technologien des Selbst. Hier begreift er die Individualisierung selbst als eine Form des Zwanges, die ebenso wie eine übertriebene hegemoniale Unterdrückung uns als Subjekt in uns hindert, jene Freiheit zu finden, die zwar nie Machtfreiheit sein wird, die aber mehr Offenheit versprechen kann. Leider fehlt in seinem Konzept jedoch eine strikt interaktionistische Perspektive, die ihm Möglichkeiten erschlossen hätte, die Grenzen und neuen Unschärfen solcher Offenheit noch breiter zu thematisieren.
Wenn McCarthy beschreibt, dass Foucault in seinen Arbeiten zwischen einer Machtbeschreibung schwankt, die einerseits alles funktional deutet, in Strukturen situiert und von unpersönlichen Feldern und Kräften bestimmt sieht, andererseits – im Spätwerk – die konstruktive Seite des Erstellens eigener Regeln, Normen, Praktiken betont, mit denen sich die Menschen selbst transformieren, um daraus den Schluss zu ziehen, dass keines der beiden Projekte geeignet sei, einen angemessenen Rahmen für eine kritische Sozialforschung zu liefern (1993, 114 f.), so halte ich dies, wo McCarthy doch gerade auf faire Argumentationen pocht, durchaus für einen Ausdruck von Unfairness. Diese Unfairness besteht darin, dass weder die konkreten Leistungen in diesen Projekten bestritten noch ihre Bedeutung verleugnet werden kann. Das einzige, was stört, ist, dass Foucault nicht zum eigenen Ansatz passt. Diese konkrete Praxis mit einem unliebsamen Kritiker zeigt, dass es offensichtlich doch nicht so einfach ist, gerecht zu verfahren, wenn es um eigene Theorie-(Macht-)Ansprüche geht. Dem ersten Weg wirft McCarthy Eindimensionalität und Reduktionismus vor (ebd., 114). Dies aber gelingt nur durch die höheren Weihen der Abstraktion, denn die konkreten Analysen von Machtpraktiken werden auch von ihm kaum bestritten. Sollten wir hier fairerweise nicht von neuen Dimensionen und von Differenzierungen des Blickens sprechen, selbst wenn wir Foucaults Analysen in ihrer Konsequenz nicht teilen sollten? Dem zweiten Projekt hält McCarthy entgegen, dass er einseitig alle Beziehungen als durch Strategien geprägt sieht und sich dem autonomen Subjekt als Geltungssubjekt verweigert (ebd.). Diese Kritik aber trifft sofort den Kritiker. Sein vermeintlich autonomes Subjekt spukt ja ohnehin nur als kontrafaktischer Geist durch die Vorstellungen, wobei McCarthy sogar zugeben muss, dass das rationale Ideal wohl nicht im Sinne eines Alles oder Nichts, sondern nur eines Mehr oder Weniger vorkommen mag (ebd., 100 f.), was letztlich Foucault in seinen praxisnäheren Analysen damit indirekt recht gibt. Dennoch will ich den Vorwurf der Unfairness zugleich einschränken: Wer wollte denn heute in irgendeiner Auseinandersetzung sich idealtypisch fair verhalten können, wenn die Macht, wie Foucault es sagt, alle Lebenssphären durchdringt? McCarthy selbst liefert in seiner Praxis als Kritiker so ein Beispiel für Foucaults Theorie und nicht gegen sie.
Wenn Freud sagt, dass wir unser Begehren in seiner Suche nach Lust nicht abschaffen, sondern allenfalls in seinem Leid, das es an der realen Welt erfährt (Streit des Lust- gegen das Realitätsprinzip), vermindern können, so scheint die Machtanalyse von Foucault ein ähnliches Problem für das gesellschaftliche Leben zu charakterisieren. Wir können die Macht nicht abschaffen, aber solange eine Demokratie in ihren Praktiken und Institutionen das Selbst in seinen Freiheitsansprüchen nicht wesentlich unterdrückt, sondern ihm hinreichend Freiräume lässt, scheint eine relativ zufrieden stellende Lösung möglich. Allerdings spricht Foucault so nun gerade nicht. Er ist nicht angetreten, uns als Rekonstruktivist unserer unterdrückenden Zustände mit diesen zu versöhnen, sondern er will als Dekonstruktivist an einer wesentlichen Stelle unsere Gewohnheiten und Lösungen verstören. Als Konstruktivist, als Akteur, griff er mehrfach in politische Situationen ein, wenn es darum ging, unsymmetrische Machtverhältnisse zu bekämpfen. Er hatte aber nicht die Illusion eines reinen Kampfes für reine Gerechtigkeit, sondern nur den eines aktuellen Kampfes für begrenzte Gerechtigkeit. Eine solche dekonstruktivistische Verstörung ist für eine konstruktivistische Beobachtertheorie ebenfalls wesentlich. Dies meint aber nicht, dass sich interaktionistische Konstruktivisten nun ausschließlich nur noch mit Machtaspekten in ihrer Beobachtertheorie oder Teilnehmer- und Akteursanalysen beschäftigen sollten. Die Macht ist jedoch einer der notwendigen Aspekte, die in einer konstruktivistischen Theorie, die sich den Lebensweltphänomenen stellen will, vorkommen muss.
Dabei können wir dem Grundanliegen von Foucault folgen, wenn er uns auf drei Verharmlosungen aufmerksam machen will, die in der Theoriebildung immer gerne einsetzen, wenn man sich für seine Ordnung der Blicke oder Dinge entscheidet: (1) Zunächst sollten wir unseren Willen zur Wahrheit selbst in Frage stellen. (2) Dann sollten wir den Diskursen ihren Ereignischarakter wiedergeben. (3) Schließlich sollten wir die Souveränität des Signifikanten aufheben (Foucault 1978, 35).
Unser Wille zur Wahrheit ist stets durch Macht subvertiert. Diskurse sind Gedankenkonstrukte, die mit den Ereignissen widerstreiten, auf die sie sich beziehen. Wir müssen uns den soziokulturellen Praktiken zuwenden, wenn wir nicht in der Gewohnheit bloßer Theoriebildungen um ihrer selbst willen stecken bleiben wollen. Dies wäre eine Übersetzung seiner Anliegen.9 Ich will an dieser Stelle die Übersetzung in eine Neuformulierung seiner Ansprüche aus interaktionistisch-konstruktiver Sicht verwandeln, indem ich Foucaults methodische Grundsätze (ebd., 35 ff.) unter Einbezug weiterer Arbeiten aufnehme und erweitere:
Über die Notwendigkeit von Wahrheitsproduktionen
In der Aufklärung sind Vernunftgründe dafür aufgerichtet worden, um uns die Notwendigkeit von Wahrheitsproduktionen mit allgemein menschlichen Zielsetzungen zu verbinden: Ein humanes Leben, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, wirtschaftlicher und sozialer Wohlstand, Selbstbestimmung und Menschenrechte, Menschenwürde und Sittlichkeit begleiten neben vielen anderen Verallgemeinerungen aus Religion, Ästhetik usw. diesen Prozess der Formation von „wahrem“ Wissen. Dadurch, dass Foucault seinen Fokus auf die Macht in ihrer Triangulation mit Wissen und Wahrheit richtet, verschieben sich einige gewohnte Perspektiven. Neue Bilder erzeugen neue Beobachtungen, die gewohnte Denkbilder verstören. Interessant ist dabei, dass Foucault nicht so wie ich von einer Unterscheidung der Beobachter-, Teilnehmer- und Akteursbereiche ausgeht, um so klarer zu situieren, aus welchen Perspektiven wir etwas begründen und artikulieren, sondern dass er innerhalb des Fokus der Wissenschaft durch die teilnehmende Spezifik seiner Beobachtungen bereits genügend Unschärfe auf der Seite der Machtverhältnisse auszumachen versteht, die vieles von dem implizieren, was ich aus anderen Blickwinkeln zu zeigen versuche.
Diese Implikation verwundert nicht. Die Macht als Ausdruck von Repression, von Unterdrückungsmechanismen ist insbesondere auf der psychoanalytischen Diskursebene vollzogen worden, wobei eine Bewegung von Sigmund Freud über Wilhelm Reich zu Herbert Markuse nachgezeichnet werden könnte. Die andere Perspektive wird durch Nietzsche, dem Foucault besonders verbunden ist, eingeführt: Macht erscheint als kriegerische Auseinandersetzung von Kräften, die wir als Machtverhältnisse zusammendenken. Beide Perspektiven schließen sich nicht aus, aber die Unterdrückungsthese, so haben wir gesehen, bleibt für Foucault zu einseitig. Machtbeziehungen durchqueren für ihn sowohl die individuellen wie die sozialen Körper einer Gesellschaft. Aus dieser Anwesenheit schließt er auf einen Zusammenhang zwischen der Produktion von Wahrheit und Macht. Unsere Ausgangsbedingung scheint dabei die folgende zu sein: „Wir müssen die Wahrheit sagen, wir sind gezwungen oder dazu verurteilt, die Wahrheit zu bekennen oder sie zu finden. Die Macht hört nicht auf, uns zu fragen, hört nicht auf, zu forschen, zu registrieren, sie institutionalisiert und professionalisiert die Suche nach der Wahrheit und belohnt sie.“ (Ebd., 76) Und so, wie die moderne Welt als ungeheure Warenansammlung entsteht, so müssen wir auch die Wahrheit anhäufen und ständig neu produzieren, um überhaupt unsere Reichtümer produzieren zu können. Unsere Technik, produzierende Wissenschaft und Erziehung sind so organisiert, dass sie auf den Schrei der Wahrheit hören, in ihm sich die Mechanismen ablauschen, die die Erfindungen leiten und den materiellen Reichtum erzeugen. Auf der anderen Seite ist die Wahrheit ein Territorium, das verwaltet wird, und dessen Verwaltung dazu dient, uns zu reglementieren, selektieren, disziplinieren usw. So sehen wir ein Gebilde, das sich in Rechtsregeln, Machtmechanismen und Wahrheitswirkungen verzweigt und in diesen zirkuliert, Foucault aber als jenen Beobachter, der in allerlei Zickzackbewegungen, wie er selber vermutet, dieses Gebilde durchquert, um insbesondere die Machtverhältnisse in ihren haarfeinen Verästelungen, in ihren regionalen, lokalen und singulären Formen und Institutionen anzugehen, um sie in ihren inneren Intentionen, d.h. ihren „realen“ und konkreten Praktiken zu erfassen und in ihren Zirkulationen zu beschreiben. Foucault steht vor einem Netzwerk, vor Wechselwirkungen und Spannungsverhältnissen, in dem sich jedes Eins wiederum zu Auchs umformt.
Allerdings reicht dies nur bis zu einem bestimmten Punkt: Macht ließe sich ja durch allerlei andere Kategorien ersetzen. So könnten wir behaupten, dass wir alle Faschismus im Kopf haben ebenso wie wir Macht im Körper haben (ebd., 83). Macht ist andererseits nicht die best verteilte Sache der Welt, auch wenn sie es in gewisser Hinsicht ist (ebd.). Sie ist, so will ich Foucault interpretieren, ein Fokus, der für bestimmte Perspektiven sehend macht und die Schärfe des Blickes reguliert. Und diese Schärfe des Blickes selbst soll dies Vorgehen auch ausschlaggebend begründen: „Man muss .. eine aufsteigende Analyse der Macht machen, d.h. von den unendlich kleinen Mechanismen ausgehen, die ihre Geschichte, ihren Ablauf, ihre Technik und Taktik haben und dann ergründen, wie diese Machtmechanismen von immer allgemeineren Machtmechanismen und Formen globaler Herrschaft besetzt, kolonisiert, umgebogen, transformiert, verlagert, ausgedehnt usw. wurden und werden.“ (Ebd.)
Es ist einfacher deduktiv zu denken und die Macht von oben nach unten wirken zu sehen, sie kausal zuzuschreiben; aber genau dies führt zur höheren Abstraktheit des Konstrukts, und erst in ihren unendlichen Einzelheiten erblicken wir jenes Kräftenetz, das gegenüber solcher Abstraktheit als aussagekräftiger erscheint. Foucault wechselt hier, ohne dass er dies als Beobachtertheorie explizit entwickelt, augenscheinlich in die Welt der Beziehungswirklichkeit einerseits und ihre materielle Re-Produktion als Lebenswelt oder Produktion andererseits. Er drückt sich aber in Beobachtungskategorien einer engeren wissenschaftlichen Beobachtungswelt aus. Deshalb betont er nicht die Topik, in der er argumentiert, aber es fällt nicht schwer, diese zu erschließen: Wahrheitsproduktionen werden in der engeren Beobachtungswirklichkeit als Wissen erzeugt und angehäuft, von der die Prozesse der Beziehungswirklichkeit abgekoppelt und der gegenüber sie disqualifiziert erscheinen. So schmort die Beobachtungswelt der Wissenschaft in ihrem eigenen Saft, so hat sie sich mit Mauern und Selektionsschranken gegen Grenzüberschreiter abgesichert und verallgemeinert sich doch selbst grenzüberschreitend auf alle Welt und Produktion.
Foucault versucht dies umzukehren, indem er an Bruchstellen der Beobachtungswirklichkeit – und dies sind Bruchstellen der Macht (als Ausdruck menschlicher Beziehungen) und Wahrheit des Wissens gegenüber Lebenspraktiken (als Ausdruck von Widersprüchen zwischen Beobachtungs- und Beziehungswelt und der Welt im allgemeinen und der Produktion im besonderen) – ansetzt, um neue Archive archäologisch aufzutun und hierin eine andere Ordnung der Dinge herzustellen.
Schöpfung ist das zentrale, alte Thema einer Beobachterposition, die sich von einem Sinn her versteht und aus diesem kausal ihre Legitimation ableitet. So hat man uns Autoren rekonstruiert, die über das wahre Wissen verfügen, so wirken Quellen hinreichender und gültiger Beobachtung, die auf Kontinuität von Ausschließungsgründen setzen, der Disziplin der Wissenschaft vertrauen, den Willen zur Wahrheit dokumentieren. Durch diese Kausalität jedoch wird der Beobachtungsvorrat verknappt und werden die Modi der Beobachtung reduzierend und isolierend gesetzt. Hier erscheint und wurzelt eine Macht, die Wirklichkeiten sich nach ihren Mustern konstruiert.
Wie aber ist solche Schöpfung kritisch zu bearbeiten, zu überwinden? Die Ereignisse selbst scheinen stärker zur Geltung gebracht werden zu müssen, die Regeln der Verknappung und Ausschließung sind ausfindig zu machen, die kausalen Muster sind umzukehren.
Dazu allerdings ist eine Beobachterposition erforderlich, die sich beobachtend neben oder nach oder über oder gegen usw. jene Anderen stellt, die bisher Bedeutung verknappen bzw. ausschließen. Die Aufrichtung eines solchen Beobachters jedoch endet jeweils auch in einer Art „glücklichen Positivismus“, weil er in der Rekonstruktion dieser neuen Sicht schließlich der Logik nach nicht anders verfährt als die bisherigen Ansätze. Es mag höchstens von der „höheren“ Beobachterposition gefordert sein, dass sie offener als die anderen blickt, sich kritischer selbst beobachtet, sich der Zirkularität und Konstruktivität von Beobachtungen selbst zumindest bewusst wird und bleibt. So gesehen gibt es in der Tat ein fundamentales Machtproblem in jeder Erkenntnis: Es ist die Mächtigkeit des Beobachters und sein Geschick, mit dem Beobachteten in Beziehungen Macht (auch als Teilnehmer und Akteur) zu gewinnen.
In diesen Versuchen bleibt uns Wahrheit als Forderung erhalten, aber sie ist als zeitübergreifendes Konstrukt verloren. Dieser Verlust jedoch bedarf einer Kompensation, wenn wir uns im weiteren Produzieren von Wahrheit bestimmen wollen. Für Foucault ist hierbei zunächst der Machtbegriff bestimmend, in seinen letzten Schriften die Frage der Selbsttechnik, d.h. die Frage nach jenen Mechanismen, die ein Selbst konstituieren. Die Machtfrage erzwingt, dass wir uns jenen ausschließenden Mechanismen zuwenden, die auch in unseren wissenschaftlichen Versuchen den Blick auf uns selbst verschleiern.
Die Suche nach Ausschlussbedingungen
Regelhaftigkeit und Ursprünglichkeit bilden jenen homogenen Stoff, aus dem die Ideen gewoben werden. Ursprünge sind durch jene Beobachter erzeugt, die wahr gesehen haben und das „Siegel einer individuellen Originalität“ tragen, zugleich jedoch in den Diskurs vorgängiger Bedeutungen eingewoben und eingetragen sind. Hier erscheint die Welt als lesbares Gesicht, das wir nur zu entdecken haben, als eine Landkarte, auf der wir jeden Punkt abgebildet finden, wenn wir nur genau genug suchen.
Solche Abbildungen sind postmodern ernüchtert. Wir sehen uns demgegenüber nun als diejenigen, die den Dingen Gewalt antun, wir zwingen ihnen unsere Praxis auf, wir beobachten das jeweils spezifisch, was uns Nutzen und Vorteil bringt. Daraus konstruieren wir uns eine Regelhaftigkeit, die niemals totalisierend glaubwürdig sein kann. Die Spezifität unserer Beobachtungen erscheint jedoch nur einer Beobachtertheorie, die die Nüchternheit solcher Konstruktivität selbst zur Kenntnis nimmt und nicht darüber ihr Dilemma vergisst, dass es bereits Regeln oder große Gelehrte gibt. In ihnen und durch sie aber atmet die Mächtigkeit von lieb gewordenen Beobachtungsvorräten und bevorzugten Modi der Beobachtung.
Ausschließungen sind in Bedeutungen gefangen. Bedeutungen scheinen ein innerer und verborgener Kern wahrer Beobachtung zu sein, der sich als Mitte eines Denkens entfaltet. Die uns aufgerichteten Beobachtungstheorien sind so schwierig, dass wir leicht unseren Nachvollzug als Rekonstruktion dieser Mitte probieren und damit der Versuchung unterliegen, uns der Disziplin anzuschließen, die uns beschränkt. Lösen wir uns von den feststehenden Modi des Beobachtens, dann verunendlicht sich der Beobachtungsvorrat. Die Modi der Beobachtung waren ja aufgerichtet worden, um die Bedeutungen zu begrenzen. Jenseits solcher traditionell überlieferter Grenzen gibt es unendliche Schätze von Bedeutungen, die wir bergen könnten, ohne je zu einem sinnvollen Ende zu kommen. Die Beobachtungsvorräte sind unerschöpflich und scheinen unendlich. Unendlichkeit aber können wir nicht beobachten, so dass wir letztlich wohl Bedeutungen verlieren müssten, um unser Problem zu lösen.
Wie aber können wir der Klammer der Bedeutung entrinnen? Äußerlichkeit scheint ein Prinzip zu sein, das wir der Verinnerlichung von Beobachtungen entgegensetzen könnten. Wir nehmen dann das Beobachtete nicht mehr als ein Verborgenes, sondern gehen von den „tatsächlichen“ Erscheinungen und den Regeln der Beobachtung und des Beobachteten selbst aus, d.h. wir versuchen uns den äußeren Möglichkeitsbedingungen, dem, was der Zufallsreihe der Ereignisse ihren Raum und ihre Zeit gibt, hinzugeben.
Doch bereits der Gedanke an einen Beobachter, der sich den Zufällen öffnet, der in Ereignissen Äußerlichkeiten zu sehen sucht, erscheint bei näherer Hinsicht als Begründung neuer Ausschließung, denn Äußerlichkeit sehe ich dort, wo ich Innerlichkeit vermeiden will. So bleibt auch hier die Forderung nach Offenheit gegenüber den möglichen Perspektiven wie eine Gebärde des Wollens, der Unsicherheit, der Bewusstheit gegenüber den Wagnissen von Beobachtungen selbst. Wir können das Problem der Mächtigkeit des Beobachters nicht ausräumen. Wir können keinen universellen Teilnehmer mehr einsetzen. Wir können die Akteure nicht gleichschalten. Die Suche nach Ausschlussbedingungen führt zu keinem Anfang und keinem Ende. Sie provoziert ein Denken in Diskontinuität. Sie lässt singuläre Ereignisse und lokale Horizonte erscheinen.
Diskontinuität und Ereignis
Kontinuität und Serie lassen immer wieder nach einer Einheit suchen, die als ein „Nicht-Gesagtes“ hinter den Beobachtungen steht und der Entschlüsselung durch den Beobachter harrt. Seine Macht wurzelt im Erkennen des Verborgenen, das er als erklärendes Band um die Dinge, die Welt, schlingen kann, um dieses Kontinuum als Einheit auszusagen. Die Beobachtungen selbst aber geben ein solches Band, ein solches Kontinuum gar nicht her. Sie unterliegen vielmehr der Diskontinuität, wobei sich diskontinuierliche Praktiken zwar überschneiden und berühren können, sich aber ebenso gut ignorieren oder ausschließen können. Es ist dann jeweils die imaginative Kraft des Beobachters selbst, die sie hin auf Kontinuität verdichtet oder verschiebt, um sich ein Ganzes zu retten. In der deutschen Diskussion ist die Entdeckung der Diskontinuität besonders blockiert (vgl. Eßbach 1991). Habermas vermutet insbesondere einen Rationalitätsabfall, der keinen übergreifenden Sinn mehr zulässt. Hier schimmert eine Abwehr gegen das Kontingente auf, das besonders angesichts einer Diskontinuität, übertragen auf die Verantwortung gegenüber der deutschen Geschichte, problematisch zu sein scheint. Dabei ist die Gefahr der rationalen Beliebigkeit jedoch eine Beobachterfiktion, die sich nur dann bewahrheitet, wenn diskontinuierliche Analysen flach und naiv werden; beides aber wird man kaum Foucault vorwerfen können. Umgekehrt jedoch müssen sich Autoren wie Habermas, Honneth oder auch Negt/Kluge fragen lassen, inwieweit ihre Wiederherstellung des mit sich versöhnten Subjekts nicht eine Beobachterillusion darstellt, wie Eßbach folgert (ebd., 82 ff.; vgl. weiterführend auch Janicaud 1991).
Eine nüchterne Beobachtertheorie sollte sich deshalb vor Übererwartungen schützen. Gleichwohl wird dieser Schutz schwierig bleiben, wenn konkrete Ereignisse beobachtet und durch die Beobachtung selbst interpunktiert werden. Der Beobachter verdichtet immer wieder Einzelheiten zu einem Muster, um klarer die Wiederholungen zu sehen, die die Zirkularität seines Beobachtens mit dem Beobachteten selbst ausmachen. Insoweit atmet der Geist der Diskontinuität nur dort, wo die Kontinuität erscheint und in ihrem Erscheinen hinterfragt werden kann und sollte. Die Kontinuität ist der Schleier eines eingerichteten Alltags, von Lebensformen, die erst bewusst werden müssen, um dekonstruiert werden zu können. Der noch so mächtige Beobachter kann sich in solcher Dekonstruktion als ohnmächtig erblicken lernen.
Foucault selbst problematisiert die ihm zugeschriebene Einstellung, dass er seine ganze Philosophie auf einer Geschichte der Diskontinuität gründe (vgl. ebd., 24 ff.). Worauf er aufmerksam machen will, ist die Differenz zwischen den wissenschaftlich formulierten Kontinuitätserwartungen, die als Konstrukt solche Wissenschaften wie Biologie, politische Ökonomie, Psychiatrie, Medizin usw. durchziehen, und den historisch feststellbaren Brüchen und Transformationen, die Kontinuitätskonstrukte erfahren. Die Kontinuitätshypothese überdeckt, dass in den Wissenschaften selbst Brüche liegen, die nicht nur zu einer Veränderung der aufgeschriebenen „wahren“ Sätze führen, sondern „viel tiefgreifender mit den Redeweisen, den Sichtweisen, mit dem ganzen Ensemble von Praktiken“ (ebd., 25) verbunden sind, um eine neue Formation des Wissens, der Ordnung des Diskurses von Wissen und Wahrheit zu begründen. Damit aber reicht es nicht aus, nach der Diskontinuität zu fragen. Man muss vielmehr rekonstruieren, wie es dazu im Einzelfall kam, dass solche Veränderungen auftraten und welche Wirkungen diese produzierten. Vorrangig erscheint Foucault bei dieser Rekonstruktion eine Analyse der Modifizierung jener Regeln, nach denen jene Aussagen entstehen, die zu einer „wahren“ Beschreibung von Aussagen führen, um die Ordnung des Diskurses anzuleiten. Die Regeln aber sind im Blick auf die Macht zu analysieren, die in ihnen in Form von Kräfteverhältnissen angelegt sind. Machtwirkungen zirkulieren unter den wissenschaftlichen Aussagen, so dass die „Ordnung der Dinge“ (Foucault 1993 a) keine reine wissenschaftliche Ordnung ist. Die Beobachterposition macht sich hier selbst geltend: Es sind jeweils Ereignisse, die als Diskontinuität erscheinen, es ist die Singularität von Ereignissen, die den Erfindungen des Re-Konstrukteurs zugrunde liegen. Wie aber lässt sich ein Ereignis unter der Struktur einer Konstruktion fassen, die immer schon mit bestimmten Perspektiven, mit zuschreibenden Linien der Sichtbarmachung, mit begriffsorientierten Zuschreibungen von Aussagen sich dem nähert, was wie ein unstrukturierter, bisher nicht gedachter, irrationaler und amorpher Ort der Un-Ordnung, des Chaos, des Nichts usw. erscheint? So wird das Ereignis in den Bannkreis der Strukturierung genommen, um aus dem Ort der absoluten Kontingenz in die Konstruktion von Strukturen überführt zu werden. Der Strukturalismus ist für diese Ordnungssuche ein sehr konsequenter Ausdruck.
Foucault beschreibt sich im Blick auf diese Ordnung als Antistrukturalist (ebd., 28): „Das Problem liegt darin, gleichzeitig die Ereignisse zu unterscheiden, ihre Beziehungssysteme und dazugehörigen Ebenen zu differenzieren und die Fäden zu rekonstruieren, die sie miteinander verbinden und bewirken, dass die einen aus den anderen entstehen.“ (Ebd.) Nicht die einzelne Symbolik ist zu analysieren, nicht das Ereignis als Ausdruck konstanter Wahrheitsbedingungen aufzufassen, sondern Ereignisse sind über Genealogien zu rekonstruieren, in denen Kräfteverhältnisse, strategische Entwicklungen und Taktiken beobachtet werden. Statt in der linguistischen Wende zu verharren, die solche Beobachtung zu sehr auf Sprache konzentriert, empfiehlt Foucault das kriegerische Beobachtungsmodell, das uns in der Geschichte mitreißt und determiniert: Eine Analyse der Praktiken rückt so vor dialektische oder semiologische Betrachtungen, die das gewaltsame, blutige, tödliche Geschehen durch die Befriedung über abgehobene theoretische Modelle umgehen.
Damit hat Foucault eine Beobachtungsperspektive umschrieben, aber er kann sich so nicht aus dem Dilemma einer Beschreibung befreien, die doch wiederum symbolisch geordnet ist. Ein Diskurs, der über andere Diskurse spricht, kann sich nicht als ein Ort letzter Wahrheit namhaft machen. Er stellt nämlich nur eine Beobachterposition hinter oder neben anderen dar. Es gehört zu den häufigen Missverständnissen gegenüber Foucault, nun doch noch nach einer abschließenden Wahrheitssicht zu suchen und damit eben das auszuschließen, was Foucault eigentlich sichtbar machen will: Diskontinuität. Ich denke, dass sowohl Manfred Frank in seinen Vorlesungen über Neostrukturalismus als auch Jürgen Habermas diesen Umstand in ihrer Kritik an Foucault unterschätzen.
Die Verlagerung auf die Kräfteverhältnisse und Praktiken ist nicht frei von jenen symbolischen Vorräten, die die Theorieabgehobenheit anderer Analysen von vornherein auszeichnen. Wir werden so dieser Gefahr bewusster, ohne sie ganz ausschließen zu können, denn die Beobachtung selbst stellt sich immer auf eine Position des Schauens außerhalb, um überhaupt jener Verhältnisse und Kräfte gewahr zu werden, die uns durchdringen. Da Foucault keine Beobachtertheorie aufstellt, fällt es ihm schwer, sich in seinem Dilemma zu situieren. Allerdings weisen seine Arbeiten genügend Beobachterperspektiven auf – so insbesondere, wenn er die Perspektiven des Autors bezeichnet. Und in diesen ist er selbst verstrickt: Es sind viele Foucaults mit unterschiedlichen Sichtweisen, die uns in seinen Werken begegnen. Aber seine Intention steht in einem klaren Bezug: Die Perspektive des Ereignisses zerstört die Kontinuitätserwartung vor allem jener heilen Symbolwelten, deren Konstrukt immer schon mit dem Ergebnis der Geschichte versöhnt ist, weil sie konstruierend wissen oder vermeinen, gewusst zu haben, worauf alles hinausläuft. Das kriegerische Schlachtfeld hingegen ist voll böser Überraschungen, die Reihen der Kämpfenden durchdringen einander, und der Ausgang der Kämpfe ist immer erst im Nachhinein gewiss. Zugleich ist ein Ende der Kämpfe nicht abzusehen, weil die Perspektive der Macht das Wissen weiterhin zirkulär durchdringen wird.
Ein ideologiekritischer Beobachter, der immer dann erforderlich erscheint, wenn Normen unhinterfragt weitergereicht und an nachfolgende Generationen vermittelt werden, steht damit vor größeren Schwierigkeiten, als es uns die Aufklärung glauben machen will (vgl. Foucault 1978, 34):
Erstens deutet auch der Begriff der Ideologiekritik noch auf eine richtige Ideologie hin, von der aus man Ereignisse als zutreffend und „wahr“ beschreiben kann. Foucault erscheint es aber als wichtiger herauszufinden, welche Wahrheitswirkungen im Inneren von Diskursen entstehen. Er bestreitet nicht die Möglichkeit und Anwesenheit von Ideologien. Aber sie sind eher abstrakte Konfigurationen, die nicht an der Basis dessen entstehen, wo das Leben in der Alltagswelt sich abspielt. „Es sind konkrete Instrumente der Herausbildung und Akkumulation von Wissen, es sind Beobachtungsmethoden, Registriertechniken, Untersuchungs- und Forschungsverfahren, Kontrollapparate. All dies bedeutet, dass die Macht über diese subtilen Mechanismen nur dann ausgeübt werden kann, wenn sie ein Wissen oder vielmehr Wissensapparate entwickelt, organisiert und in Umlauf setzt, die keine ideologischen Gebäude sind.“ (Ebd., 87)
Damit ist ein Problem der Konkretisierung bezeichnet, dieses aber keineswegs gelöst. Die ideologischen Gebäude, die wie eine gewaltige Architektur den Horizont bestimmen und die Silhouette des Denkens abgeben, mögen deutlich von den präziser beschreibbaren Mechanismen unterschieden werden. Aber in diesen verdichtet sich ebenso sehr Ideologie als Spezifikation eines Allgemeinen wie das Allgemeine umgekehrt erst aus den Spezifikationen bevölkert wird. Die Situierung eines Beobachters, von dessen Fokus wir ausgehen, zeigt uns deutlich, welche Zielrichtung wir im Sinne Foucaults einnehmen sollten: Die je spezifische Blickrichtung vom Allgemeinen zum Konkreten oder umgekehrt lässt es immer als notwendig erscheinen, dass Ideologiekritik sich möglichst an den konkreten Praktiken orientiert, um nicht in abstrakt vorausgesetzten Erwartungen zu verharren und ignorant zu verweilen. Alle hierarchisierte Wissenschaft aber steht in der Gefahr dieses Verweilens und Ignorierens.
Zweitens erscheint ein Subjekt, auf das sich eine Ideologie bezieht. Hier besteht das Dilemma zwischen einem radikalen Subjektivismus, der nur noch das autonome und isoliert ausgeschlossene Subjekt dogmatisiert, um die Unschärfe des vorausgesetzten gesellschaftlich-materiellen Feldes auszublenden, und einem Objektivismus, der zu einer Entsubjektivierung beiträgt, indem er bloß noch Wirkungsweisen von vorgängigen Systemen für das Subjekt interpretiert. Das 20. Jahrhundert ist wissenschaftlich durch beide Denkströmungen zerrissen und verwirrt. Foucault glaubt, „dass die Integration des Individuums in eine Gemeinschaft oder in eine Totalität aus der stetigen Korrelation zwischen einer wachsenden Individualisierung und der Stärkung eben dieser Totalität resultiert.“ (Foucault 1993 b, 186) Als Subjekt erlernt der Mensch in seiner praktischen Vernunft, die diese Vermittlung zu leisten hat, vor allem vier Technologien, die ihm in seinen „Wahrheitsspielen“ helfen: „1. Technologien der Produktion, die es uns ermöglichen, Dinge zu produzieren, zu verändern oder auf sonstige Weise zu manipulieren; 2. Technologien von Zeichensystemen, die es uns gestatten, mit Zeichen, Bedeutungen, Symbolen oder Sinn umzugehen; 3. Technologien der Macht, die das Verhalten von Individuen prägen und sie bestimmten Zwecken oder einer Herrschaft unterwerfen, die das Subjekt zum Objekt machen; 4. Technologien des Selbst, die es dem Einzelnen ermöglichen, aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer eine Reihe von Operationen an seinem Körper oder seiner Seele, seinem Denken, seinem Verhalten und seiner Existenzweise vorzunehmen, mit dem Ziel, sich so zu verändern, dass er einen gewissen Zustand des Glücks, der Reinheit, der Weisheit, der Vollkommenheit oder der Unsterblichkeit erlangt.“ (Ebd., 26)
Diese Technologien bedingen einander. Sie markieren zugleich Selbst- und Fremdbeobachtungsbereiche, so möchte ich hinzusetzen, die dem sinngemäß entsprechen, was ich in anderen Sichtweisen schon hervorgehoben habe. In der interaktionistisch-konstruktivistischen Theorie ordnen sich die Aspekte nur anders ein:
zu 1) die Welt der Produktion (allgemeiner: die Lebenswelt) vermittelt zwischen Beziehungs- und Beobachtungswirklichkeiten;
zu 2) die Beobachtungswelt der Zeichen durchdringt alle anderen Beobachtungsweisen, wenngleich mit unterschiedlichen Ansprüchen auf Erkenntnisschärfe;
zu 3) die Analyse von Macht ist ein wichtiger, aber nicht ausschließlicher Aspekt von Beobachtungsmöglichkeiten;
zu 4) Selbst- und Fremdzwänge erscheinen durchgängig auf der Seite des Subjekts und in den Beziehungen.
Eine Entscheidung für oder gegen eine Beobachtertheorie des Subjekts wird nach praktischen Gesichtspunkten ausgesucht werden. Sie kann weder das Dilemma des Schwankens zwischen Subjektivismus und Objektivismus vermeiden, wenn die Beziehungs- und Lebenswelt mit in die Perspektive genommen werden sollen, noch kann sie frei von der Konstruktion einer spezifischen Perspektive über ein codifiziertes Kategoriensystem sein, das ich als Beobachtungsmaxime vorschlage.
Drittens erscheint nun aber auch die Frage, welche der Seiten des menschlichen Lebens gegenüber anderen dominant sind. Steht die Ideologie in untergeordneter Form gegenüber der materiellen, der ökonomischen Struktur, die sie determiniert?
Je mehr Foucault konkrete Antworten auf diese Frage suchte, desto mehr rückte die Zirkularität von Macht vor seine Augen: Gewiss gibt es Machtpraktiken, die eine klare ökonomische Basis haben, aber sie funktionieren eben nicht bloß ökonomisch. Sie sind daher auch nicht nur in diesem Bereich auszuräumen. Die Vernetzung und Verstrickung löst sich nur in den begrifflichen Zuschreibungen nach Basis und Überbau auf, nicht aber im „realen“ Leben, das durch Beobachtervielfalt und gegensätzliche Interessen charakterisiert ist. Gerade deshalb wurde es für Foucault in seinen letzten Arbeiten interessant, den Technologien des Selbst nachzuspüren, die sich in diesen Verstrickungen ständig neu erzeugen und variieren.
Insgesamt kann und will Foucault dem mit Ideologiekritik bezeichneten Dilemma einer irgendwie doch besseren Beobachterposition (gegenüber einer anderen, nicht so guten) nicht durch einen besten Entwurf entkommen. Er kann nur Vorsicht im Gebrauch der Ideologiekritik anmahnen, ohne sie selbst als unmöglich denunzieren zu wollen. Ihre Grenzbedingung ist letztlich das Ereignis. Ereignisse zerfallen in die Unerschöpflichkeit von Beobachtungsvorräten und Haltungen des Beobachters, der sich Modi einer verallgemeinerten Beobachtung fixiert, um Archäologie und Genealogie des Diskurses zu erzeugen.
Was bleibt damit als Aufgabe eines ideologiekritischen Intellektuellen? Er hat die Macht und die Fantasie der Macht von Allwissenheit, Allgemeinheit und Universalität seines Wissens eingebüßt. Weder das Allgemeine noch das Exemplarische haben sich als Beobachterperspektive erweisen können, die für alle wahr und gerecht ist (ebd., 44). An die Stelle des „universellen Intellektuellen“ rückt der „spezifische Intellektuelle“, der in bestimmten Bereichen und an besonderen Punkten auch seiner Arbeits- und Lebensbedingungen ansetzt, um sich und Andere zu beobachten. Seine Betroffenheit erscheint „am Wohnort, im Krankenhaus, im Irrenhaus, in den Forschungsstätten, an der Universität, in den Familienverhältnissen und in der Sexualität“ (ebd.). In den täglichen Kämpfen erscheint hier mehr Gemeinsamkeit mit den Massen, weil im Alltag gleiche Gegner manifest werden: Multinationale Konzerne, der Justiz- und Polizeiapparat, die Territorialverwaltungen von Wahrheit, die ausschließenden und einsperrenden Institutionen bürgerlicher Normalität, die Eigentums- und Wohnspekulanten usw. Hier kann der Intellektuelle die Differenz überwinden, die durch die Schrift bezeichnet ist. Wo er früher vor allem Schriftsteller in der Beobachtung von Verhältnissen war, mag er sich in seinem beobachtenden Spektrum nunmehr erweitern und auch solche Beobachter politisieren, die in den Querverbindungen von Wissen zu Wissen nisten, die als Richter, als Ärzte, als Sozialarbeiter, als Verwalter von Ordnungen fungieren (ebd., 45 ff.). Der klassische analytische Blick, so die Hoffnung Foucaults, kann sich so erweitern. Es ist nicht mehr der Literat, der sich selbst auf die Schrift und die überschätzte linguistische Wende beziehen kann; es sind die in den Ereignissen stehenden und denkenden Menschen allesamt, die Beobachtungs- und Handlungsqualitäten gewinnen können, weil sie keine schwergewichtigen Wahrheiten mehr zu verlieren haben.
Lokale Singularität und Genealogie
Insofern alles beobachtbar geworden ist und die Beobachter selbst ständig ihre Plätze zu wechseln in der Lage sind, sind die Böden und Territorien des Beobachtens brüchig geworden und die Blickrichtungen schwankend. So konnte der Augen-Blick neu gedacht werden: Diskontinuierlich als Ereignis, partikular als besonderer Blick, lokal als begrenzte Perspektive in bestimmter Zeit. Jeder Beobachter unterliegt der Singularität, so dass die Wirklichkeitskonstruktionen bei Anerkennung dieses Umstandes als gehemmt im Blick auf das bezeichnet werden müssen, was noch das Denken der Moderne intendierte: Globale und ganzheitliche Theoriebildung, die als Wahrheit – wenn schon nicht für alles, so doch zumindest für fast alles – taugte (vgl. Foucault 1978, 58 ff.).
Nun ist allerdings zu bedenken, dass die globalen Theorien bis heute wirksam sind; Foucault verweist in seinem Zeithorizont z.B. auf den Marxismus und die Psychoanalyse. Gleichzeitig meint er jedoch, dass alle Theorien unter diesem Anspruch einen Bremseffekt erzeugen, der durch eine Wiederaufnahme von Kategorien der Totalität bestimmt wird. Totalisierende Normen verengen a priori die Blickwinkel, verdichten die Fragestellungen und produzieren in der Regel das, was sie erwarten. Was aber könnte demgegenüber eine lokale Theorie ausrichten, wenn man nicht von vornherein die Illusion hegen will, dass es möglich wäre, jeglicher Norm überhaupt zu entsagen? Dieser Weg, so argumentiert Foucault immer wieder, ist dadurch verstellt, dass der Zusammenhang von Macht und Wissen bzw. Wahrheit weder durch Lokalität, Singularität noch durch Anerkennung von Ereignissen und begrenzter Gültigkeit verschwindet.
Aber entsteht so nicht ein Beobachterkonstrukt, das sich nur noch naiv einem glücklichen Positivismus hingeben kann, das eklektizistisch das aufnimmt, was opportun oder naiv vorgegeben ist? Foucault bestimmt das lokale Wissen anders (ebd.):
- Ein lokaler Charakter der Kritik setzt eine autonome, nicht zentralisierte theoretische Produktion voraus, die sich nicht mehr der Gültigkeit eines übergeordneten allgemeinen Normensystems unterwerfen muss. Aber sie bleibt eben auch lokal, d.h. begrenzt.
- In solcher lokalen Kritik erscheint eine „Wiederkehr von Wissen“, die sich als Sichtbarwerden von historischen Inhalten und des Wissens von Leuten, deren Wissen wissenschaftlich meist dequalifiziert wurde. Solche Dequalifikation trifft oft Praktiker und Dekonstruktivisten. Hier ist neues Wissen zu erwerben, das nicht länger der Abstraktion und Abwendung vom Leben unterworfen wird. Hierin erscheint nach Foucault ein möglicher „Aufstand der unterworfenen Wissensarten“ (Foucault 1978, 59).
- Dieses Wissen muss sich auf die historischen Kämpfe einlassen. Dies bedingt, dass eine Verbindung „zwischen den verschütteten Wissensarten der Gelehrsamkeit und den von der Hierarchie des Wissens und der Gelehrsamkeit disqualifizierten Wissensarten“ (ebd., 61) gefunden wird, was ein seltsames Paradox hervorruft: Die unterworfenen Wissensarten bezeichnen nämlich zugleich die verallgemeinerten gelehrten Blicke des Wissens wie die von diesen disqualifizierten Blicke eines als Nicht-Wissen verdrängten Wissens.
- Daraus erwächst das, was ein Beobachter beider Perspektiven sich als Genealogie konstruieren kann: Eine Wiederentdeckung von Kämpfen und verschwommenen Ereignissen. „Als Genealogie bezeichnen wir also diese Verbindung zwischen gelehrten Kenntnissen und lokalen Erinnerungen, die die Konstituierung eines historischen Wissens der Kämpfe ermöglicht sowie die Verwendung dieses Wissens in den gegenwärtigen Taktiken.“ (Ebd., 62)
Was aber bleibt dann noch als theoretisches Beobachterspektrum? Es sind „lokale diskontinuierliche, disqualifizierte Wissensarten“, die ein kritischer Beobachter vorrangig ins Spiel zu bringen hätte, um als Anti-Wissenschaft den hergebrachten Anspruch auf wahres Wissen, auf Filterung, Hierarchisierung und Klassifikation durch wahrhaft einzig befugte und legitimierte Instanzen aufzugeben. Genealogien bedingen damit Widerstand gegen die Einschreibung von Wissensarten in die Hierarchien der etablierten Wissenschaften; sie fordern Widerstand gegen die Zwänge eines vereinheitlichenden, formalisierten theoretischen Diskurses. An ihrer Seite erscheint eine Archäologie, deren Aufgabe es ist, als spezifische Methode die lokalen Diskurse zu analysieren. Durch sie erscheinen die Geneaologien, die aus der Unterwerfung befreite Wissensarten taktisch spielen lassen. Die Aufgabe des wissenschaftlich kämpfenden Akteurs und Beobachters ist damit doppelt: Ausgrabung der verschütteten Diskurse durch Analyse, Spiel mit den Ausgrabungen durch taktische Demonstration von befreiten Wissensarten.
Solche Lokalität steht in der Versuchung, Ignoranz oder Nicht-Wissen zu provozieren. Zumindest kann Foucault nicht begründen, wie diese ausgeschlossen bleiben sollen, wenn eben die Territorialverwaltungen der „Wahrheitsausschlüsse“ selbst aufgegeben werden sollen. Um dies zu erreichen, will Foucault den Beobachter weniger gegen die Wissenschaft an sich kämpfen lassen, als vielmehr „gegen die zentralisierenden Machtwirkungen, die mit der Institution und dem Funktionieren eines wissenschaftlichen Diskurses verbunden sind“ (ebd., 63). Aber kann dies den Beobachter in seinen Aktionen immer zielgerichtet leiten? Der Beobachter wird so unter die Maxime gestellt, gegen alle Machtwirkungen eines wissenschaftlichen oder für wissenschaftlich gehaltenen Diskurses anzukämpfen, was in der Versuchung steht – denkt man diese Idee auf ihre letzte Konsequenz –, dann doch wieder nur eine Perspektive einzunehmen.
So sitzen wir bereits in der Falle von Verallgemeinerungen: Diese eine Perspektive, die davor schützen soll, andere einzunehmen, diese Kämpfe zu bevorzugen und nicht jene zu führen. Aber die lokalen, diskontinuierlichen und disqualifizierten Blicke bleiben singulär und ereignisbezogen, entbehren der Universalität, unter die die Machtperspektive sie andererseits stellen will.
Ist damit die Beobachtertheorie Foucaults an ihre spezifische, lokale Grenze gerückt? Ich glaube, dass Foucault uns mehr zu sagen vermag. Die hier erreichte Grenze ist eine Grenzbedingung innerhalb der Unschärfe in der Lebenswelt, aber nicht in einer engeren Beobachtungswirklichkeit, wie sie das wissenschaftliche Denken gemeinhin symbolisch favorisiert. Es ist zunächst die Paradoxie, dass wir eine allgemeine Aussage treffen, um diese Grenze gleichsam für alles Wissen zu universalisieren, dabei aber im gleichen Atemzug betonen, dass dies lokal, singulär, diskontinuierlich, partiell usw. aus der Perspektive eines Beobachters (in bestimmter Aktion und Teilnahme) geschieht. Wir können dies nur formulieren, weil wir den Fokus aus der Perspektive eines dritten Beobachters einführen, der scheinbar spielerisch auf diesen Umstand herunterblickt, obwohl auch er leicht, indem er sich einlässt, in den Fallen jener sitzt, die er beobachtet.
Erst auf dieser Grundlage mögen wir darüber streiten, ob Foucault nun zu einseitig die Macht strapaziert.10 Wir gewinnen dafür zumindest ein gutes Verständnis, wenn wir es mit den Bewegungen der sprachpragmatischen Wende, der Psychoanalyse oder dem Marxismus kontrastieren, von denen sich Foucault durch seine lokalen Blickwinkel absetzte. Hatten sie nicht genau jenen Kampf der Mächte übersehen, den Foucault uns in bemerkenswerten Studien differenzierte? Foucault selbst illustriert dies dadurch, dass er die Vereinheitlichung und Verallgemeinerung, die von seiner Denkweise ausgeht, eher als gering einschätzt. Die Fragmente der Genealogie, die bisher vorgelegt wurden, so sagt er, sind „umgeben von zurückhaltendem Schweigen“ (ebd., 67). Darin schwingt eine nüchterne Bescheidenheit: „Das Schweigen, oder vielmehr die Vorsicht, mit der die einheitlichen Theorien die Genealogie der Wissensarten umgehen, wäre also vielleicht ein Grund, weiterzumachen. Jedenfalls könnten auf diese Weise die genealogischen Fragmente in Form von Fallen, Fragen, Herausforderungen ... vermehrt werden. Aber es ist letztlich wahrscheinlich allzu optimistisch – denn es geht ja um eine Schlacht, und zwar die der einzelnen Wissen gegen die Machtwirkungen des wissenschaftlichen Diskurses –, würde man das Schweigen des Gegners als Beweis dafür nehmen, dass wir ihm Angst machen.“ (Foucault 1978, 67) Immer dann, wenn sie sich zu neuen Wahrheiten verfestigen, gehörte Foucault zu den ersten, sein Programm zu modifizieren. Erkennen wir durch diese Unruhe der Bewegung nicht erst, was Ereignisse bedeuten, ohne sie je ganz erfassen zu können? Lernen wir dadurch nicht überhaupt erst, uns selbst in diesem Spektrum von Beobachtungswelten zu situieren, was die Erkenntnis einschließt, dass wir immer nur Teil jener Landschaft sind, die wir durch Wechseln der Beobachtungsorte uns sichtbar und sagbar machen wollen? Dann erkennen wir Foucault als einen neben und zwischen uns, im Nach- und Nebeneinander der Beobachter situiert, dessen Wegen und Blicken wir folgen mögen oder auch nicht. Da er eher noch zu den von der Mehrheit der Wissenschaftler disqualifizierten Beobachtern zu rechnen ist, mögen unsere Sympathien spontan auf seiner Seite sein, wenn wir erkannt haben, dass Disqualifizierungen zu den Spielregeln einer ausschließenden Vernunft gehören. Gerade diesbezüglich gehört Foucault zu den wenigen, die dies gegen den Strom konventioneller Wissenschaft aufdeckten, um dann bei anderen zu einer eigenen Konvention erhoben zu werden. Reflektieren wir hingegen seinen Gang durch die skizzierten unterschiedlichen Landschaften als kritischen Impuls, dann werden wir uns am Beispiel der Macht eines gemeinsamen Dilemmas bewusst, das er durchschritten, beobachtet und beschrieben hat.
Symbolisches, Imaginäres und Reales bei Foucault
In den Arbeiten Foucaults dominiert das Symbolische. Das Symbolisieren im Prozess der gesellschaftlichen Entwicklung erscheint immer wieder ausgedrückt durch Symbole, die wir rekonstruieren können. Hier findet nach Foucault im Prozess der Moderne eine wesentliche Verschiebung der Beobachtungsperspektive statt. Im Übergang in die neuere Zeit dominiert noch eine Theorieentwicklung, die juristisch negativ ausgrenzt. Sie beruft sich auf die Institution der Monarchie, in der ein Monarch als Souverän gilt, dessen Gewalt und Macht über alle Funktionen der Gesellschaft zu herrschen scheint. Beobachtungstheorien werden hier zu Gefangenen einer Betrachtung, die immer nach Souveränität sucht. Sie finden dann Gesetze, Verbote, Unterdrückung. Sie begreifen sich nicht selbst als nach einer Blickweise konstruiert, die noch monarchisch befangen ist. Wird hingegen dem König der Kopf abgeschlagen, dann ist ein Perspektivenwechsel möglich: Mächte- und Kräfteverhältnisse über den Staat und seine Gesetze hinaus werden auf einmal sichtbar, denn der vermeintlich omnipotente Staat hat in den Ereignissen gar nicht alle Machtverhältnisse besetzt. Die Verschiebung der Perspektive erlaubt es, nun die Macht von unten, in ihren Wurzelwerken zu beobachten, damit auch zu analysieren, wie sie sich mit der Macht von oben durchdringt und wie sich beide Perspektiven miteinander verweben. In seinem Spätwerk zeigt sich dieses dekonstruktive Anliegen bei Foucault – auch gegen seinen eigenen Ansatz – deutlich.
Damit aber will er auch dem Realen auf die Spur kommen, die doppelt gelegt ist: Das Reale erscheint einerseits in all den Lebensweisen als Hintergrund, die sich eine symbolische Hülle zugelegt haben. Es kann nur einer mühseligen Archäologie gelingen, Spuren dieses Realen in den symbolischen Hinterlassenschaften über das hinaus, was gesagt und geschrieben ist, freizulegen. Andererseits aber ist Foucault als Beobachter ein Jäger des Realen, weil und insofern er vermutet, dass die symbolischen Ordnungen nicht in dem aufgehen, was sie symbolisieren. Die symbolische Ordnung verbirgt etwas, was Foucault zu dekonstruieren sucht, weil alles Symbolisieren durch reale Ereignisse (Hintergründe) subvertiert ist. Aber nur durch symbolische Arbeit kann man dies aufdecken.
Dieses Spannungsverhältnis zwischen dem Symbolischen und Realen artikuliert der interaktionistische Konstruktivismus sehr deutlich. Stärker noch als bei Foucault ist es für mich wichtig, diese Artikulation in eine Beobachtertheorie einzubinden, die sich zugleich des re/de/konstruktiven Charakters der Unterscheidung von symbolischen Akten und realen Ereignissen bewusst ist. Dabei finden wir aber in symbolischer Rekonstruktion nicht eine Macht „da draußen“, sondern immer eine von uns re/de/konstruierte Macht, die mit eigenen Wahrnehmungs- und Interessenlagen notwendig verbunden ist.
In dieser Verbindung bleibt das Imaginäre bei Foucault leider unterschätzt, wenngleich es implizit durchaus von ihm eingeführt und beachtet wird. Viele Bilder und Metaphern, die Foucault in seinen Werken gebraucht, deuten auf den imaginären Raum hin, für den Foucault sensibel war. Aber es gelingt ihm nicht, diese Sensibilität auf eine interaktionistische Sicht hin zu erweitern. Dies zeigt sich besonders deutlich in den „Technologien des Selbst“, seinem Spätwerk. Wenn wir als vier Bereiche der Herstellung von Macht als Techniken auf die Produktion, den Zeichengebrauch (die Sprache), die Herrschaft und das Selbst sehen sollen, dann bleiben so – auch in Bezug auf das Selbst – relativ äußerliche Beobachterpositionen, die zu wenig die Dynamik des wechselseitigen Spiegelns und Anerkennens auch auf der imaginären Achse der Kommunikation entfalten. Dennoch lassen sich Foucaults Arbeiten immer wieder sehr gut auch in den breiteren Ansatz des interaktionistischen Konstruktivismus aufnehmen (vgl. auch Kapitel IV.3.3.3.2), weil und insofern er sich nah an den lebensweltlichen Praktiken der Macht orientiert.
Foucault kann uns durch seine Setzungen helfen, differenziert über die Macht und Probleme der Mächtigkeit im Prozess des Beobachtens nachzudenken. Da er die Schwankungen seines eigenen Beobachterstandpunktes aber wenig diskutiert, fällt es Habermas (1991 a) nicht schwer, auf die Widersprüchlichkeit zwischen Archäologie und „glücklichen Positivismus“ zu verweisen. Andererseits ist damit jedoch ein Dilemma ausgedrückt, dem auch Habermas nicht entgehen kann, wie es überhaupt keine Theorie vermag, die sich dem Problem von Fremd- und Selbstbeobachtung stellt: Die Widersprüche zwischen Kausalität und Zirkularität von Ereignissen, zwischen Kontinuität und Diskontinuität, zwischen Regelhaftigkeit und Ursprung und Spezifität, zwischen Bedeutungen und den Möglichkeiten von Bedeutungen beobachtend auszuhalten und sich nicht einseitig an Ausschließungsgründen zu befriedigen. Foucaults Ansatz gibt uns genügend Hinweise darauf, wo mögliche Schwachstellen der Beobachtung liegen können: Ursprungsdenken und ein präsentistisches Zeitbewusstsein der Moderne, das Privilegien eines Anfangs, eines kausalen Verlaufs dogmatisiert und die Kontingenz übergeht; ein vorgängiges Verstehen, das sich nur selbst beweist und die destruktive Seite der Beobachtung, die nicht hintergehbare Komplexität und Unschärfe der beobachteten Ereignisse vernachlässigt; ein Makrobewusstsein von Welt, das nach globaler Geschichtsschreibung tendiert, sich große Kausalität entwirft und illusionäre Kontinuität konstruiert, um sich in totalen Entwürfen in einer Wunschwelt zu befriedigen.
Es bleibt die Frage, inwieweit in der Hinwendung zur Realität des Diskurses Foucaults bestimmender Fokus der Beobachtung einer Suche nach Macht, mit der er die Masken der Wiederholung zu erklären versucht, auch für einen konstruktivistischen Ansatz maßgebend ist. Der Hintergrund seiner These ist gewiss zeitgeschichtlich. Bei Foucault ist ein Schwanken zwischen sehr präzisen Herleitungen und hypothetischen Verallgemeinerungen immer wieder erkennbar. Nur eine Werkanalyse, die die Veränderungen in Foucaults Denken selbst mitmacht, wird zu einer Differenzierung beitragen können (für den Subjektbegriff vgl. einführend aus interaktionistisch-konstruktivistischer Sicht Dahlmanns 2008). Auch hier ist wieder die Reflexion der Beobachterposition gefragt: Aus welcher Perspektive wird Macht gedeutet, welcher Sinn ergibt sich dem konstruierenden Beobachter hieraus und welcher Sinn wird einem anderen damit verstellt? Ohne diese Fragen bleiben Foucaults Analysen doch wieder abgehobene Bilder von Ausschließungen, Maskeraden und Suggestionen, also Ereignisse, die er eigentlich bekämpfen wollte.
Habermas verweist auf das Scheitern marxistischer Ansätze, die sich in einer immer gleichen Denkfigur verdichten und in dieser nur minimal variieren: „im Universalismus der Aufklärung, im Humanismus der Befreiungsideale, im Vernunftanspruch des Systemdenkens selbst ist ein bornierter Wille zur Macht angelegt, der, sobald die Theorie sich anschickt, praktisch zu werden, die Maske abwirft – hinter der der Machtwille der philosophischen Meisterdenker, der Intellektuellen, der Sinnvermittler ... hervorkommt.“ (Habermas 1991 a, 302) Diese Macht erscheint aber nur, wenn wir den Blickwinkel wechseln, und sie scheint in diesem Wechsel ohne Alternative zu sein. Bei Foucault findet sich hier ein entscheidender Hinweis auf eine Beobachtertheorie, die auch Habermas (ebd., 304 ff.) analysiert. Foucault interpretiert hierzu das berühmte Bild der „Hofdamen“ von Velazquez, das bereits oben in Band 1 (Kapitel I) eine Rolle spielte. Ich nehme es hier nochmals in die Argumentation auf: Das Bild zeigt den Maler vor einer für den Zuschauer nicht sichtbaren Leinwand. Der Maler blickt ebenso wie die ihm benachbarten Hofdamen in Richtung seiner beiden Modelle, des Königs Philipp IV. und seiner Frau. Auch wenn diese beiden Modelle außerhalb des Bildes stehen, so sieht der Zuschauer sie im Hintergrund eines abgebildeten Spiegels. Der Zuschauer rekonstruiert damit eine Abwesenheit. Foucault analysiert nun dieses Abwesende. Zunächst fehlt dem Maler in dem Bild sein Modell. Dem Modell, wenn wir die Beobachterposition wechseln, fehlt Einsicht in die Leinwand des Malers. Dem Zuschauer aber fehlt sowohl das Modell als auch die Einsicht in die Leinwand, gleichwohl verweisen die Blicke des Malers als auch der Hofdamen und die Spiegelung auf die Bedeutsamkeit der Szene. Es ist damit ein Bild, das Lücken hinterlässt, die durch die jeweiligen Beobachterpositionen erschlossen und gefüllt werden. Damit aber ist die Brüchigkeit des Abbildens selbst gezeigt, denn Vorstellendes und Vorgestelltes fallen auseinander, die abzubildenden Souveräne finden sich nicht in der Abbildung repräsentiert, sie sind, wie Foucault sagt, darin nie selbst präsent. Diese Interpretation dient ihm dazu, die Stellung des Menschen in einem bestimmten Zeitalter zu entlarven. In einem großen Bogen der Argumentation erschließt er von Kant über Fichte bis hin zu Husserl und Heidegger, „dass die Moderne durch die selbstwidersprüchliche und anthropozentrische Wissensform eines strukturell überforderten Subjekts, eines sich ins Unendliche transzendierenden endlichen Subjekts ausgezeichnet ist.“ (Ebd., 307) Der Wille zur Wahrheit erscheint als eine Größe, die die Beobachtungsleistungen in ihrer Differenzierung einebnet. Aber Foucault geht nicht den Weg, die von ihm aufgewiesene Beobachterposition selbst als Möglichkeit der Situierung einer konstruktivistischen Beobachtertheorie zu sehen. Dabei ist dieses Bild ein Beleg gerade für die Notwendigkeit einer Beobachtertheorie. Das Bild von Velazquez zeigt eine Perspektive, die als Perspektive nur von den unterschiedlichen Standpunkten konstruierender Beobachtung wahrgenommen werden kann (vgl. dazu ausführlicher Reich/Sehnbruch/Wild 2005). Es ist damit ein Bildereignis, das sich als Bild thematisiert und Blickrichtungen suggeriert, um Befremdliches zu Tage zu fördern. Der Reiz dieses und ähnlicher Bilder der Verfremdung liegt darin, dass sich die Beobachtungen des Zuschauers in verschiedene Positionen von Beobachtern versetzen können, was die Realität des Ereignisses selbst in mehrere Realitäten und unterschiedliche imaginäre Verwendungen spaltet. Es ist nun der symbolische Kitt von Meistern der Beobachtung, der uns als Kunstgeschichte oder adäquate Bildbetrachtung jenen Riss wieder versiegeln soll, den wir im Umherwandern durch die Perspektiven spüren. Es ist ein Riss, der die Mächtigkeit des Beobachters und Beobachtens selbst ausdrückt, aber nicht nur Macht im Sinne von Foucault, auch wenn die Perspektive der Macht gerade für dieses Bild auffällig ist. Aber Macht als eine Kategorie des Beobachtens ist nur eines der möglichen Muster des Schauens. So wird eine Szene der Repräsentation von Macht durch die möglichen anderen Blickwinkel zur Entdeckung von anderen Personen oder Dingen, an denen sich die Beobachtung festhalten und aus denen die Imaginationen sich Weiteres spinnen können, um andere ideelle oder dabei ideale Gebilde zu erzeugen.
Es gehört zu den Besonderheiten der impliziten Beobachtertheorie Foucaults, dass sie im Willen zum Wissen und zur Wahrheit sich immer auch ein Bild der Macht erzeugt, das ganz ähnlich wie bei Nietzsche zu einem Bestimmungsgrund dessen wird, was beobachtet werden soll. So wie ich Foucault in seinen methodischen Grundsätzen umdeutete, ist diese Begrenzung zwar verständlich, aber andererseits unnötig. Foucault hat dies wohl in seinen letzten Schriften selbst gesehen, wenn er sich stärker den Techniken des Selbst zuwandte, um darin Aspekte einer Selbstbemächtigung zu differenzieren. Eine Machtanalyse wird im Blick auf die historische Analyse immer produktiv sein, weil sie sich an ein Ereignis der Moderne heftet, das unter den Mänteln sogenannter Wahrheit oft verschleiert wird. Aber die Mäntel verschleiern mehr, die Beobachterperspektiven können den Fokus auch auf andere Konstellationen richten, um ebenfalls problematische Konstrukte der Moderne zu entdecken. Macht wird so von mir nur als eine Beobachterkategorie neben anderen verstanden. Von solcher Macht, die sich als Herrschaft, als Ausschließung, als Verbot, Grenzziehung, als Wille zur Wahrheit entwickelt, will ich die Mächtigkeit des Beobachters unterscheiden. Beziehen wir nämlich die bisherige Analyse auf das Verhältnis von Zirkularität und Macht, dann erscheint als Grundlage aller Machtverhältnisse diese Mächtigkeit, ohne dass ich diese jedoch auf Macht reduzieren kann. In der „Wille zum Wissen“ schreibt Foucault: „Unter Macht, scheint mir, ist zunächst zu verstehen: die Vielfältigkeit von Kräfteverhältnissen, die ein Gebiet bevölkern und organisieren; das Spiel, das in unaufhörlichen Kämpfen und Auseinandersetzungen diese Kräfteverhältnisse verwandelt, verstärkt, verkehrt; die Stützen, die diese Kräfteverhältnisse aneinander finden, indem sie sich zu Systemen verketten – oder die Verschiebungen und Widersprüche, die sie gegeneinander isolieren; und schließlich die Strategien, in denen sie zur Wirkung gelangen und deren große Linien und institutionelle Kristallisierungen sich in den Staatsapparaten, in der Gesetzgebung und in den gesellschaftlichen Hegemonien verkörpern.“ (Foucault 1992 b, 113f.)
Diese Definition lässt sich sehr gut auf die Unterscheidung einer Beziehungswirklichkeit von einer Beobachtungswirklichkeit im engeren Sinne (insbesondere der Wissenschaft) und im weiteren Sinne (Welt- und Produktionswirklichkeit) beziehen. In der Beobachtung von Beziehungen wirken Machtpraktiken als Kräfteverhältnisse, wohingegen sie in der engeren Beobachtungswirklichkeit eher stören und gerne von Wissenschaftlern eliminiert werden. Nur so ist die im 20. Jahrhundert zu beobachtende Suche nach wertfreier Beobachtung zu verstehen, die sich gerade des Machtaspekts entledigen will. Foucault ist aufmerksam genug, solche Denunziation von Macht schonungslos als Illusion aufzudecken. Insbesondere gegen eine linke Kritik, die Macht nur in dem Souverän des Diskurses des Herren (siehe dazu unten Kapitel IV.4) identifiziert, klagt er die beziehungsmäßige Macht ein: Sie ist ein Name für eine komplexe strategische Situation in der Gesellschaft, mithin für einen sozialen Komplex menschlicher Beziehungen, die die Wirklichkeiten von Menschen durchqueren und Kräfte darstellen. Hierin erscheint – nun in meiner Sprache – die Mächtigkeit von Beziehungen, die immer solche Kräftelinien beinhaltet: „Allgegenwart der Macht: nicht weil sie das Privileg hat, unter ihrer unerschütterlichen Einheit alles zu versammeln, sondern weil sie sich in jedem Augenblick und an jedem Punkt – oder vielmehr in jeder Beziehung zwischen Punkt und Punkt – erzeugt.“ (Ebd.) Hier verharrt Foucault noch in einer Beobachtung, die die Beziehungswirklichkeit nicht gesondert ausweist: Von Punkt zu Punkt, das ist, wenn es sich um interagierende Menschen handelt, der Bereich ihrer Beziehungen selbst, die sich als Selbst- und Fremdmächtigkeit durchdringen und Praktiken von Macht neben anderen Praktiken erzeugen.
Was geschieht in dieser Erzeugung? Zunächst ist jede individuelle Beobachtung in ihrer Suche nach Ausschließung ein reduktiver Vorgang, in dem die Mächtigkeit des Beobachtens selbst erscheint. Jedes Subjekt entwickelt diese Mächtigkeit, indem es beobachtet. Es ist die Konstruktion selbst, die aus dem Dilemma eines Konstruierten nicht heraus kann, um sich zu konstruieren. Hier schlagen sich die Kränkungsbewegungen nieder, die ich weiter oben diskutiert habe. Sie zeigen sich in aller Macht dem beobachtenden Subjekt und konstituieren in je unterschiedlicher Weise zugleich seine Mächtigkeit. Es ist die subtile oder grobe Macht, das sehen zu wollen, was man will, die Augen vor dem zu schließen, was nicht gesehen werden soll oder darf usw.
Diskutieren wir diese Mächtigkeit unter der Perspektive der Rekonstruktion, eines Willens zur Wahrheit, die bereits vorgängig ist, dann erscheint schnell die Ohnmacht der Subjektivität und die Allmacht der Objektivität, die sich als Welt-, Volks- oder Regionalgeschichte geltend macht und in der Lebensform des Subjekts schicksalhaft erscheint. Foucault kann diese Sicht nicht allein einnehmen, denn er will Macht verdeutlichen, indem er sie in den Praktiken rekonstruiert. Damit jedoch braucht er selbst einen mächtigen Beobachter, der die rekonstruktive Macht durch die Konstruktivität seiner Sicht bewältigt. Foucault schwankt nun zwischen solcher Mächtigkeit und den sehr konkreten Machtpraktiken, die bei ihm ausschließend gegen andere mögliche Perspektiven erscheinen. Deshalb sollte man die Aporien bei Foucault nicht so scharf kritisieren, wie es Habermas tut (1991 a, 313 ff.), weil der Sprung zwischen einer Archäologie und einer Genealogie letztlich nur ein Fokuswechsel ist, um das Dilemma einer „Situierung in“ und einer „Situierung von“ zu lösen. Kein Beobachter kann sich in seinem Verständnis von Kommunikation aus dieser Falle ziehen. Gleichwohl bleibt die Kritik bestehen, dass Foucault diese eigene Gefangenschaft methodologisch zu wenig diskutiert.
Aber muss er dies überhaupt? Reicht denn nicht seine Kritik von Machtpraktiken weit über das hinaus, was in der Wissenschaft gemeinhin im Diskurs von Mächtigkeit und Ohnmacht diskutiert wird?
In seinem Vorwort zum „Anti-Ödipus“ von Deleuze und Guattari können wir einen Blick auf Foucaults implizites Verständnis von Mächtigkeit gewinnen. Er beschreibt hierin nochmals die Gefangenschaft, der sich insbesondere linke Intellektuelle in Frankreich von 1945 bis 1965 ausgesetzt sahen, in der sie alle am Diskurs von Marx, Freud und der Zeichentheorie – dem Diskurs der Signifikanten – sich zu beteiligen hatten, um sich und Andere aussagen zu können. Der „Anti-Ödipus“ nun signalisiert eine Wende, da er keine neuen Idole aufzurichten vermag, sondern allein motiviert, selbst weiter zu gehen, denn er bekämpft die verschiedensten Richtungen:
„1. Die politischen Asketen, die traurigen Militanten, die Terroristen der Theorie, diejenigen, die die reine Ordnung der Politik und des Diskurses bewahren möchten. Bürokraten der Revolution und Beamte der Wahrheit.
2. Die armseligen Techniker des Wunsches – Psychoanalytiker und Semiologen jedes Zeichens und Symptoms –, die die Vielfalt des Wunsches unter das Joch des doppelten Gesetzes der Struktur und des Mangels zwingen möchten.
3. Der Hauptfeind, der strategische Gegner ist nicht zuletzt der Faschismus (während der Widerstand, den der „Anti-Ödipus“ den beiden anderen gegenüber leistet, mehr von der Art eines taktischen Engagements ist). Und nicht nur der historische Faschismus, der Faschismus Hitlers und Mussolinis – der fähig war, den Wunsch der Massen so wirksam zu mobilisieren und in seinen Dienst zu stellen –, sondern auch der Faschismus in uns allen, in unseren Köpfen und in unserem täglichen Verhalten, der Faschismus, der uns die Macht lieben lässt, der uns genau das begehren lässt, was uns beherrscht und ausbeutet.“ (Foucault 1978, 227 f.)
Zugespitzt ließe sich sogar behaupten, dass der Anti-Ödipus selbst den ersten beiden Sichtweisen angehört, aber sie aus ihrem Dogma löst, indem der Text idealtypisch Perspektiven chaotisch zu wechseln intendiert, was eine neue Freiheit provoziert. Es ist dies eine neue Unverbindlichkeit, so mögen die einen schreien. Es ist die Aufgabe des Theorieanspruchs, so mögen die anderen vermuten. Für Foucault ist es eine Wende, die exemplarisch dafür steht, dass man das Denken nicht gebrauchen soll, „um eine politische Praxis auf Wahrheit zu gründen“ (ebd., 229). Die politische Programmatik lautet vielmehr: „Verlange von der Politik nicht die Wiederherstellung der „Rechte“ des Individuums, so wie die Philosophie sie definiert hat! Das Individuum ist das Produkt der Macht. Viel nötiger ist es, zu „ent-individualisieren“, und zwar mittels der Multiplikation und Verschiebung, mittels diverser Kombinationen. Die Gruppe darf kein organisches Band sein, das hierarchisierte Individuen vereint, sondern soll ein dauernder Generator der Ent-Individualisierung sein. – Verliebe Dich nicht in die Macht!“ (Ebd., 229 f.)
Beziehen wir diese neue Programmatik auf die Wissenschaft, die sich mit Foucault einer Beobachtertheorie stellt, die sich selbst in ihrer Mächtigkeit beschreibt, dann fällt auf, dass diese Wissenschaft Wahrheiten produziert, die weder außerhalb der Macht stehen noch ohne Macht sind. Foucault beschreibt fünf Faktoren, die diese Mächtigkeit, die in ihr steckende „politische Ökonomie“ der Wahrheit, charakterisieren:
- „die Wahrheit ist um die Form des wissenschaftlichen Diskurses und die Institutionen, die ihn produzieren, zentriert;
- sie ist ständigen ökonomischen und politischen Anforderungen ausgesetzt (Wahrheitsbedürfnis sowohl der ökonomischen Produktion als auch der politischen Macht);
- sie unterliegt in den verschiedensten Formen enormer Verbreitung und Konsumtion (sie zirkuliert in Erziehungs- und Informationsapparaten, die sich trotz einiger strenger Einschränkungen relativ weit über den sozialen Körper ausdehnen);
- sie wird unter der zwar nicht ausschließlichen aber doch überwiegenden Kontrolle einiger weniger großer politischer oder ökonomischer Apparate (Universität, Armee, Presse, Massenmedien) produziert und verteilt;
- schließlich ist sie Einsatz zahlreicher politischer Auseinandersetzungen und gesellschaftlicher Konfrontationen („ideologischer“ Kämpfe).“ (Ebd., 52)
Wahrheit ist mithin ein diesseitiges, sehr weltliches, strittiges und auf Verständigungsgemeinschaften bezogenes, ein zugleich regionales, hierarchisiertes und spezifisches Bestimmungsproblem. Solche Wahrheit führt notwendig auf den Punkt, die Wahrheitsträger, die Intellektuellen zu entwerten, indem die Werte überhaupt fragwürdig werden. Der vielfach beklagte Werteverlust der Moderne am Ende des 20. Jahrhunderts korrespondiert mit der Macht von Wissenschaft, die nicht mehr um das Wahre an sich ringt, sondern um ein Ensemble von Regeln, „nach denen das Wahre vom Falschen geschieden und das Wahre mit spezifischen Machtwirkungen ausgestattet wird“ (ebd., 53). Damit rückt eine neue Definition von Wahrheit in den Horizont, die durch und durch konstruktivistisch ist:
Wahrheit ist ein Ensemble von geregelten Verfahren, das sich auf verschiedene Beobachterbereiche bezieht. Für Foucault liegen diese in „Verfahren für Produktion, Gesetz, Verteilung, Zirkulation und Wirkungsweise der Aussagen“ (ebd.). Daraus aber folgt die notwendige Zirkularität von Wahrheit: „Die „Wahrheit“ ist zirkulär an Machtsysteme gebunden, die sie produzieren und stützen, und an Machtwirkungen, die von ihr ausgehen und sie reproduzieren.“ (Ebd., 54) Solche Macht hört nicht auf, wenn wir politische, ideologische oder historische Systeme wechseln. Solche Zirkularität scheint für alle menschlichen Lebensweisen, sofern sie überhaupt Wahrheit konstruieren, wesentlich. Sieht man dies ein, dann kann es nicht mehr Aufgabe des Intellektuellen sein, die richtige Ideologie herauszufinden, sondern bescheidener nach der möglichen neuen Politik der Wahrheit zu suchen, sie zu konstruieren, um sie lebbar zu machen. Aber eine solche Politik lebt ja auch bereits in Institutionen, die mächtig auf uns wirken. Insoweit ist „die Macht der Wahrheit von den Formen gesellschaftlicher, ökonomischer und kultureller Hegemonie zu lösen, innerhalb derer sie gegenwärtig wirksam ist.“ (Ebd.) Zugleich ist die Mehrperspektivität des Intellektuellen jedoch eine Einschränkung dieser Forderung, denn in dem Maße, wie ich meine richtige Ideologie verliere, verliere ich auch an Motiven, bis zu jener Grenze zu streiten, an der ich alles aufgeben will, was vor mir liegt, um Neues zu schaffen. Der ernüchterte Intellektuelle weiß hingegen, dass es immer noch mehr, immer noch weitere, immer wieder andere Wege an ein ohnehin offenes Ziel gibt, was als Eingeständnis alleine schon einen Rückzug bedeuten kann. Und hier mögen die Fallen der bereits institutionalisierten Wahrheit in der Form der Wissenschaft zuschlagen, denn sie weisen dem Intellektuellen je seinen Bezugspunkt und seinen Käfig der Abarbeitungen zu. Die Territorien sind verteilt, die Ströme der Zeit in künstliche Abflüsse geordnet, die Stürme vorhersehbar und die Schutz- und Trutzburgen sind gerüstet, um selbst die imaginativen Hurrikane und Überflutungen, die Dekonstruktivisten anzetteln, zu überstehen. Die Wahrheit ist zirkulär, die Macht ist es. Gegenüber Foucault kann ich anmerken, dass ich ihn längst in einer Beobachtersphäre situiert haben, die ich Lebenswelt nenne, die Versuche scharfen Beobachtens ebenso umfasst wie sehr unscharfe Beziehungen. In dieser Lebenswelt gibt es Bezüge zur Beobachtungswirklichkeit im engeren Sinne – der Welt der Wissenschaft mit ihren Trutzburgen der Wahrheit, wie sie eben herausgearbeitet wurden – und der Welt der Produktion – nicht nur von Aussagen, sondern auch von Vergegenständlichungen –, mit der wir unseren zunehmenden Reichtum genießen und in den wir – verteilt nach arm und reich, gespalten nach Luxus und Elend – zirkulär verwoben sind. Macht ist hierbei zwar nur eine der vielen möglichen Beobachtungsperspektiven, aber sie ist eine – das lernen wir von Foucault –, die sich durchgängig und immer wieder thematisieren lässt, weil wir sie in jedem Augen-Blick – selbst in unserer Mächtigkeit als Beobachter – vermuten müssen.
Schauen wir auf Beziehungen, dann suchen wir meist schon intuitiv jenen Umschlag zu ergründen, der von der Mächtigkeit eines Subjekts (seiner Persönlichkeit, Ausstrahlung, Körpersprache, seinem Eros usw.) umschlägt in die Macht, die uns erwischt. Auf einmal sind wir betroffen, getroffen oder gemeint; es erscheint uns je nach eigenem Befinden, nach unserem Selbst und unserer Mächtigkeit, dass das, was geschieht, mit uns geschehen soll. Sind wir gefragt? Sind wir beteiligt? Ist Anerkennung hier wechselseitiges Anerkennen von Gleichen? Ist hier jener idealtypische Ort des herrschaftsfreien Diskurses, den sich Habermas als Voraussetzung einer idealen Sprechbedingung erträumt? Nein, mit Foucault wissen wir, dass dieser Traum uns nur hilft, nochmals genauer nach der Perspektive der Macht zu schauen, die als unabdingbare Folge von Mächtigkeit, von Andersheit, von Möglichkeit zirkulärer Begegnung überhaupt auftritt. Dann aber haben wir ein neues Problem, das unser scheinbar freies Schauen in einen Schauer überführt: Die Angst vor der Überwältigung. Wenn denn Wahrheit im Sinne einer Eindeutigkeit und Absolutheit von unumstößlicher Zuweisung verloren ist, wenn Wahrheit kein sesshafter, sondern ein nomadischer Wohnort ist, wie Foucault sagt, wenn die Kategorien des Negativen wie Gesetze, Grenzen, Kastrationskomplexe, Mangelwesen usw., die als Ausschließungsgründe die Wissenschaften bevölkern, durch Multiplität, Differenzen und produktive Kreativität zu ersetzen sind, wo bleibt dann die Grenze, die eben noch zumindest radikal zum Faschismus gezogen wurde? Könnte nicht jener Faschist eines Tages mit seiner Konstruktion kommen, um unter dem Mantel der freien Denkweise alle auf neue Uni-Formen zu verpflichten? Und wäre diese neue Sesshaftigkeit nicht für viele ein erwünschter Ort, weil sie die Unübersichtlichkeit, diesen Karneval der Begriffe und Theorien sogenannter Postmoderne nicht länger ertragen?
Aber was schützt uns am besten vor dem Faschismus? Ich denke, es sind die Dekonstruktivisten, wenn sie sich hinreichend vermehren können.
3.3.2.2 Strategisches oder kommunikatives Handeln?
Nach meinem Beziehungsmodell aus dem dritten Kapitel ist deutlich, dass menschliches Handeln von mir im Kontext von Selbst- und Fremdbeobachterkonstrukten gesehen wird, wobei aufgrund eines Mangels an letzten Beobachtern mit gültigen Normen kein eindeutiges Ideal der Kommunikation aufstellen kann. Kritisch ist zu fragen, ob dies notwendig ist. Verlieren wir damit nicht Kriterien für eine Kommunikation, wie sie zumindest sein sollte?
Jürgen Habermas, auf den ich mehrfach eingegangen bin, hat das hier vorliegende Problem auf den Gegensatz von strategischem und kommunikativem Handeln zugespitzt (vgl. Band 1, Kapitel II.2.4). Rekapitulieren wir noch einmal das damit verbundene Problem im Blick auf die Beziehungswirklichkeit und Lebenswelt.
Beziehungen werden durch Beobachter beschrieben, die in unterschiedlichen Verständigungsgemeinschaften pluralistisch – und das heißt mitunter geradezu gegensätzlich und widersprüchlich – organisiert sind. Ihre Argumente weisen keinen metaphysischen Hintergrundkonsens mehr auf, der Abweichungen von universellen Normen an der Oberfläche erklären ließe, sondern alle Erklärungen sind in einen Notstand geraten: Es scheint vollständig der Beliebigkeit sozialer, kultureller, moralischer usw. Gemeinschaften überlassen, was den Gehalt einer Moral sowie die Achtung einer solidarischen Verantwortung der Gesellschaftsmitglieder rechtfertigen kann (vgl. Habermas 1997, 56). Folgende Folgerung scheint naheliegend: Auch alltägliche Beziehungen benötigen eine Diskursethik, um überhaupt mittels rationaler Kriterien angeben zu können, in welchen zugelassenen und wünschenswerten Formen ihr Zusammenleben organisiert werden soll. Aber Beziehungen zu führen, bedeutet scheinbar, keinen Diskurs zu führen, der wissenschaftlichen Kriterien genügt.
Beziehungen finden in Gemeinschaften statt. Wir erkennen sie heute aber nicht mehr als Einheit, sondern als Vielheit von pluralen, diversen, multikulturellen und dabei heterogenen und differenten Gemeinschaften. Nun hat Habermas allerdings a priori eine Setzung getroffen, die den Beobachterfokus verengt. Er rekonstruiert die Gemeinsamkeiten solch pluralistischer Gemeinschaften unter dem Vorbehalt der Verständigung. Er meint, dass die Beteiligten nicht vorrangig durch Macht oder Kompromisse ihre Konflikte bewältigen, sondern durch Verständigung beilegen wollen (ebd.). Zwar ist er sich des idealtypischen Charakters dieser Setzung bewusst, aber er fundiert ihn theoretisch dadurch, dass er das kommunikative Handeln als Diskurstheorie besonders ausweist und die Bedingungen seiner Verallgemeinerbarkeit thematisiert.
Der interaktionistische Konstruktivismus ist hier bescheidener, aber damit gewiss auch unzulänglicher. Durch die ausgewiesene Rolle des Beobachters und durch das Eingeständnis, die Beobachter, Teilnehmer und Akteure nicht mehr auf ein substanzielles Einverständnis von Normen, Werten und Beobachtungsperspektiven, Teilnahme- und Akteursbedingungen einschwören zu können, gerät der Konstruktivismus in eine diskursethische Schieflage: Er kann nicht hinlänglich erklären, welche Lebensform die wünschenswerteste ist. Aber dies scheint auch Habermas zuzugestehen: „Freilich lässt sich aus den Eigenschaften kommunikativer Lebensformen allein nicht begründen, warum die Angehörigen einer bestimmten historischen Gemeinschaft ihre partikularistischen Wertorientierungen überschreiten, warum sie zu durchgängig symmetrischen und unbegrenzt inklusiven Anerkennungsbeziehungen eines egalitären Universalismus übergehen sollten.“ (Ebd., 57) Wie aber kann dann noch eine universalistische Einsicht festgehalten werden, die den zerbrochenen Gemeinschaften in ihrer Pluralität den verbliebenen notwendigen Konsens vor Augen hält?
Habermas präzisiert den Anspruch sehr deutlich: „Die Gleichbehandlung ist eine von Ungleichen, die sich ihrer Zusammengehörigkeit gleichwohl bewusst sind. Der Aspekt, dass Personen als solche mit allen übrigen Personen gleich sind, darf nicht auf Kosten des anderen Aspekts, dass sie als Individuen von allen anderen zugleich absolut verschieden sind, zur Geltung gebracht werden. Der reziprok gleichmäßige Respekt für jeden, den der differenzempfindliche Universalismus verlangt, ist von der Art einer nicht-nivellierenden und nicht-beschlagnahmenden Einbeziehung des Anderen in seiner Andersartigkeit.“ (Ebd., 57 f.)
Für Habermas ist es völlig klar, dass die Formen des kommunikativen Handelns, so wie wir sie als Gewohnheitsbildungen und Verpflichtungen erfahren, nicht ausreichen können, eine Universalisierung zu erreichen. Das kommunikative Handeln ist ein Konstrukt von Reflexionen: „Argumentationen weisen per se über alle partikularen Lebensformen hinaus.“ (Ebd., 58) Ist dieser erste Schritt erst einmal gegangen, dann kann ich nach Übereinstimmungen von Normen in allen kommunikativen Gemeinschaften suchen, um diese zu einer Theorie kommunikativen Handelns zu verallgemeinern. Ihre Basis ist schmal und verweist auf Bedingungen, in die anerkannte Ungleichheit wenigstens Grundbedingungen von Gleichheit zurückzuführen. Erst aus diesem Wertmaßstab heraus erscheint dann das strategische Handeln als eine Handlungsart mit niedrigerer Gesinnung und Wertigkeit, wenngleich es lebenspraktisch dominant ist.
Für die Welt des Rechts, den sich alle Menschen zumindest in demokratischen Kulturen zu beugen haben, mag eine solch begrenzte Universalisierung schon aus pragmatischen gründen wechselseitiger Handlungskoordinationen und einer gewissen Sicherheit des Zusammenlebens nicht nur einsichtig, sondern auch unumgänglich erscheinen. Aber dies sind immer normative Mehrheitsentscheidungen, die Interessenlagen und durchgesetzte Machtpositionen mehr als eine universelle kommunikativ gerechte Struktur symbolisieren. Aus der Sicht von Beziehungen gibt es keine vollständig symmetrischen Beziehungen. Ein egalitärer Universalismus verstellt uns in der Regel den Zugang zu den subtilen Machtverhältnissen in Beziehungen, wie wir im vorherigen Abschnitt diskutieren konnten. Beziehungen setzen in der kommunikativen Lebensform an und sind hier immer auf die Brüche in den Beobachtungen von Selbst- und Fremdbeobachtern bezogen. Der Andere in seiner Andersheit dominiert, wenn wir diese Brüche in den Vordergrund unseres Interesses stellen. Dies wird überall dort sichtbar, wo Selbst- und Fremdbeobachter je nach ihren Imaginationen verfahren und ihre bestimmte symbolische Weltsicht durchsetzen wollen. Dies wäre auch nur durch imaginäre Gleichschaltung und symbolische Vereinheitlichung zu beseitigen. Da dies andererseits bei zunehmendem Pluralismus und einer Individualisierung von Beobachterperspektiven, bei einer Multiplizierung von Teilnahmebedingungen und -rollen, einer Differenzierung von Akteursweisen immer schwieriger wird, erscheint die heutige Beobachtungswelt als eine Welt der zunehmenden Willkür in allen Perspektiven.
Mit Habermas können wir nun sagen, dass wir dies nicht wollen. Wir wollen auch die Kommunikation in Beziehungen auf Verständigung hin orientieren. Dann müssten wir Regeln der Kommunikation finden, die diese Verständigung erst ermöglichen und sinnvoll begrenzen. Diese Begrenzung müssten wir aus einer Rekonstruktion gesellschaftlicher Praktiken legitimieren, um nicht in ein abstraktes Substanzdenken zurückzufallen. So könnten wir ableiten, was wir beobachten sollen.
Als Konstruktivisten sind wir an dieser Stelle überfordert. Wir können allenfalls Re/De/Konstrukte errichten, die von Beobachtern aufgenommen und auf der Grundlage ihrer Verständigungsgemeinschaft behandelt werden: Aufnehmen, abwehren, übersehen oder vergessen sind hier alltägliche Formen. Als Universalisierung müssten wir Beziehungen lehrbar machen; doch diese scheinen unbelehrbar.
Worin wurzelt die Unbelehrbarkeit? Habermas hat den wichtigsten Punkt dazu selbst angemerkt: In der Andersartigkeit des Anderen. Diese gilt schon symbolisch. Erst recht haben wir sie für den Bereich des Imaginären zuzugestehen. Real werden wir immer wieder überrascht.
Allenfalls ein kognitiv-rationales Lernkonzept könnte uns auch in Beziehungen helfen, diese Lehrbarkeit doch noch herzustellen. Es müsste ein Sozialisationskonzept rekonstruierbar sein, das zeigt, dass kommunikative Rationalität entstehen kann (vgl. dazu ausführlich Habermas 1988, I, 25 ff.). Was müsste hier geschehen? Es müsste eine Rationalität entwickelt werden, die Konnotationen mit sich führt, „die letztlich zurückgehen auf die zentrale Erfahrung der zwanglos einigenden, konsensstiftenden Kraft argumentativer Rede, in der verschiedene Teilnehmer ihre zunächst nur subjektiven Auffassungen überwinden und sich dank der Gemeinsamkeit vernünftig motivierter Überzeugungen gleichzeitig der Einheit der objektiven Welt und der Intersubjektivität ihres Lebenszusammenhangs vergewissern.“ (Ebd., 28)
Solche Rationalität sichert die Zurechnungsfähigkeit von Menschen, insofern Menschen in Gemeinschaften dann als zurechnungsfähig gelten, wenn sie ihr Handeln an intersubjektiv anerkannten Geltungsansprüchen orientieren (ebd., 34). Dies macht, so können wir mit Foucault sagen, auch ihre Disziplinierung aus. Aber Habermas sieht es eher als Chance einer Verständigung. Und hier konstatiert er unter Rückgriff auf Piaget einen Lernprozess in der Menschheitsgeschichte, der in evolutiven Sprüngen erreicht zu sein scheint (vgl. ebd., 104 ff.). Die historisch feststellbare Zunahme an kommunikativer Rationalität zeigt sich in einer Erweiterung der Handlungsspielräume, mit denen Handlungen zwanglos koordiniert und Konflikte konsensuell beigelegt werden können (ebd.). Dies gilt auch für die Alltagspraxis (ebd., 37), was auf die Beziehungswirklichkeit hin orientiert.
Was nun jedoch die emotionale, oft irrational erscheinende Seite von Argumentationen in den Beziehungen betrifft, so gesteht Habermas zu, dass Wahrheits- und Richtigkeitsansprüche der Argumentation hier nicht wirklich eingelöst werden können. Die Wahrhaftigkeit lässt sich in diesem expressiven Bereich nicht diskurstheoretisch begründen, sondern sie zeigt sich nur in Äußerungen. Hier sind Selbsttäuschungen möglich (ebd., 69). Hier ist aber auch deshalb kein Diskurs im Sinne von Habermas möglich, denn die geäußerte Kritik bleibt inneren und äußeren Zwängen unterworfen. Ein Diskurs unter dem Anspruch kommunikativen Handelns und kommunikativer Rationalität muss sich von vornherein auf den problematisch gewordenen Geltungsanspruch einlassen, wenn der Anspruch auf Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit von Aussagen als notwendiger Konsens von Verständigung nicht unterlaufen werden soll.
Aus konstruktivistischer Sicht kann diese Verortung des Problems nicht befriedigen. Im Blick auf Beziehungen kann ich keinen Beobachter ausmachen, der die Anforderungen der formalen Gemeinsamkeitsunterstellungen (ebd., 82) einhalten kann, ohne die beteiligten Anderen mit seiner spezifischen Sicht einer bestimmten Teilnahme und Aktion zu überformen. Lassen wir nämlich die mögliche Vielzahl von Selbst- und Fremdbeobachtern in einer beliebigen Beziehungskonstellation zu, dann zerfällt die eben noch unterstellte objektive, d.h. für alle Beobachter identische und argumentativ konsensuell nachvollziehbare, und die intersubjektiv sozial geteilte Welt in die Unterschiedlichkeit von unterschiedlichen Wahrnehmungen und Wahrheiten. Allenfalls in Konzentration auf eine harmonisierte symbolische Welt könnte es so scheinen, als wäre eine Einigung möglich. Dies ist in der Tat die abstrahierte Erfahrung von Verständigungsgemeinschaften, die ihren Hintergrundkonsens reflektieren und als Sozialisationsleistung an die nachfolgende Generation (insbesondere in den konventionell geregelten Felder des Rechts und der Technik) verallgemeinern. Nun will aber Habermas gerade dies nicht. Er wehrt sich vehement gegen die Übernahme von traditionalen Gewohnheiten und spezifischen Inhalten und Normen, die eine Präjudizierung von Sprache und Wirklichkeit darstellen (ebd.). Die Pointe bei Habermas lautet: „Die Kontextabhängigkeit der Kriterien, anhand deren die Angehörigen verschiedener Kulturen zu verschiedenen Zeiten die Gültigkeit von Äußerungen differentiell beurteilen, bedeutet aber nicht, dass die der Wahl von Kriterien freilich nur intuitiv zugrunde liegenden Ideen der Wahrheit, der normativen Richtigkeit und der Wahrhaftigkeit oder Authentizität in gleichem Maße kontextabhängig sind.“ (Ebd., 88)
Damit kann es einen gemeinsamen Kontext in gewissen Bereichen geben. Aber welche Beobachter sollen dies konstatieren? Aus der expressiv orientierten Beziehungswelt können sie offensichtlich nicht kommen, denn für diese gilt der Begriff des Diskurses nicht. Es kann sich also nur um ein Verfahren handeln, das in Beziehungen situiert ist, die möglichst von allen Emotionen, Imaginationen, Strategie- und Machtverhältnissen gereinigt sind. Es sind dies offensichtliche Anti-Beziehungen, die dem Alltag schon entflohen sind: Es können zumindest keine Beziehungen sein, die komplementären Charakter tragen und Macht zum Ausdruck bringen; die einen Habitus darstellen, der Unterschiede und Andersartigkeiten zwischen den Menschen betont, indem er unterschiedliche Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemata erzeugt (vgl. Kapitel IV. 3.3.1.1); auch nicht solche, die in einer unscharfen Beziehungslogik stehen, wie ich sie in Kapitel III betont habe. Habermas entwickelt, was Beziehungen betrifft, einen – böse formuliert – ethnozentrisch-kolonialen Stil, den er allerdings reflektiert und begrenzen will (vgl. ebd., 89 ff.). Sein Problem besteht jedoch darin, dass er in ethnologischer Begegnung mit anderen Völkern über einen kommunikativen Rationalitätsstandard verfügt, der von einer Art höchstem Beobachter stammt und die bisherige Entwicklungsgeschichte als Rekonstrukt vereinnahmt. Dies ist das, was Stuart Hall mit „The West and the Rest“ bezeichnete, als hegemoniale Denkweise des Westens und abgeleitet aus seiner Aufklärungsphilosophie. Aus diesem Rekonstrukt heraus gibt es eine evolutive Geschichte auch der menschlichen Beziehungen, die sich zu einem immer rationaleren Standard hin entwickelt.
Um dies zu verdeutlichen, führt Habermas den Begriff des Weltbildes an. Und er vergleicht ihn mit dem menschlichen Antlitz: einem Portrait. Weltbilder, so sagt er (ebd., 92), sind keine Abbildungen wie Landkarten, die genau oder ungenau sein können, sie sind auch keine Sachverhaltswiedergaben, die wahr oder falsch sein können, sondern sie bieten einen Blickwinkel, in dem eine dargestellte Person in spezifischer Weise erscheint. „Deshalb kann es von derselben Person mehrere Portraits geben; diese können den Charakter unter ganz verschiedenen Aspekten zum Vorschein bringen und doch in gleicher Weise als zutreffend, authentisch oder angemessen empfunden werden. In ähnlicher Weise legen Weltbilder den grundbegrifflichen Rahmen fest, innerhalb dessen wir alles, was in der Welt vorkommt, in bestimmter Weise als etwas interpretieren. Weltbilder können so wenig wie Portraits wahr oder falsch sein.“ (Ebd.)
Der Unterschied jedoch zu den Portraits liegt nun darin, dass Weltbilder wahrheitsfähige Aussagen ermöglichen. Sie haben zumindest einen indirekten Wahrheitszugang. Dies bezieht sich darauf, dass eine Verständigungsgemeinschaft jeweils Weltbilder als Geltungsanspruch vertritt.
Was Habermas an dieser Stelle auslässt, das scheint mir entscheidend zu sein. Er situiert keinen Beobachter, obwohl dies gerade durch die Veranschaulichung mit dem Portrait naheliegt. Welcher Beobachter sieht dieses Portrait von einem Weltbild? Welcher Beobachter hat es gemalt? Welche Teilnahmebedingungen setzt er voraus? An welche Akteursmöglichkeiten ist er gebunden? Sind alle Beobachter mit dem Bild im Bilde? Wie viele Varianten des Portraits sind zugelassen, zumutbar, für die Beobachter teilnehmend und handelnd nachvollziehbar usw.?
Erst aus der Beantwortung dieser Fragen ließe sich ableiten, was Habermas direkt setzt: „Zwar sind Weltbilder durch ihren Totalitätsbezug der Dimension enthoben, in der eine Beurteilung nach Wahrheitskriterien sinnvoll ist; sogar die Wahl der Kriterien, nach denen jeweils die Wahrheit von Aussagen beurteilt wird, mag von dem grundbegrifflichen Kontext eines Weltbildes abhängen. Daraus folgt aber nicht, dass die Idee der Wahrheit selbst partikularistisch verstanden werden dürfte.“ (Ebd.)
Wir könnten mit Habermas durchaus einverstanden sein, wenn der letzte Satz auf einen Beobachter zurückbezogen wäre. Dieser wäre in seiner Verständigungsgemeinschaft dann die zunächst letzte Position, von der aus die Rekonstruktion der nicht partikularen Wahrheitsmomente behauptet wird. Er wird als Beobachter im Nach- und Nebeneinander (aber hier erscheint schon die letzte Position als Illusion!) mit Sicherheit abgelöst werden. Aber genau diese Ablösung verweigert Habermas im prinzipiellen Sinne. Ein anderer Beobachter kann gar nicht von vorne oder ganz anders anfangen. Zwar wechseln die Inhalte und Formen in der Lebenswelt, aber die Behauptung einer grundlegenden, universalen Vernunft in einer formalen Grundübereinkunft bleibt als letzter Anspruch eines letzten Beobachters als seine Teilnahmevoraussetzung bestehen. Der Konstruktivismus ist hingegen eine Theorie, die auch die Teilnahmevoraussetzungen als prinzipiell veränderlich ansieht, ohne sie damit als willkürlich zu behaupten. Aber die gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaften bieten neben konventioneller Verbindlichkeit, die selbst durchaus schwankend ist, so viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, so gegensätzliche Interessen und Veränderungen in den hegemonialen Kämpfen um die Lebenswelt und Produktionswirklichkeit an, dass selbst der strukturelle Kern von Menschenrechten oder anderen Rechten oder wissenschaftlichen Einsichten (in der Technik und engen wissenschaftlichen Standards) uns nicht von der Vielfalt, Widersprüchlichkeit und Ambivalenz der Verflüssigung unserer Lebensverhältnisse retten kann (vgl. dazu weiterführend z.B. die Titel von Bauman im Literaturverzeichnis).
Nach dieser einführenden Analyse kann ich mich nun konkreter kritisch mit den Kriterien auseinandersetzen, die Habermas aufführt. Welche Kriterien für das kommunikative Handeln in einer wissenschaftlichen Argumentationspraxis sind wesentlich? Nennen wir mit Habermas nur die vier wichtigsten:
„(a) niemand, der einen relevanten Beitrag machen könnte, darf von der Teilnahme ausgeschlossen werden; (b) allen wird die gleiche Chance gegeben, Beiträge zu leisten; (c) die Teilnehmer müssen meinen, was sie sagen; (d) die Kommunikation muss derart von äußeren und inneren Zwängen frei sein, dass die Ja/Nein-Stellungnahmen zu kritisierbaren Geltungsansprüchen allein durch die Überzeugungskraft besserer Gründe motiviert sind. Wenn nun jeder, der sich auf eine Argumentation einlässt, mindestens diese pragmatischen Voraussetzungen machen muss, können in praktischen Diskursen, (a) wegen der Öffentlichkeit und Inklusion aller Betroffenen und (b) wegen der kommunikativen Gleichberechtigung der Teilnehmer, nur Gründe zum Zuge kommen, die die Interessen und Wertorientierungen eines jeden gleichmäßig berücksichtigen; und wegen der Abwesenheit von (c) Täuschung und (d) Zwang können nur Gründe für die Zustimmung zu einer strittigen Norm den Ausschlag geben. Unter der Prämisse der wechselseitig jedem unterstellten Verständigungsorientierung kann schließlich diese ‚zwanglose‘ Akzeptanz nur ‚gemeinsam‘ erfolgen.“ (Habermas 1997, 62)
Es muss deutlich sein, dass hier ein spezifischer argumentativer Diskurs gemeint ist, der „nicht auf interpersonale Beziehungen außerhalb dieser Praxis“ (ebd.) verallgemeinert werden kann. Habermas lässt die Motive für Handlungen in Beziehungen bewusst außen vor, er konzentriert sich auf den Zugang zu einem herrschaftsfreien Diskurs.
Sehen wir dies von der Wissenschaftlichkeit her, so können wir scheinbar unproblematisch zustimmen. Aus der Beziehungssicht hingegen lassen sich zahlreiche Einwände gegen die vier wichtigsten Eigenschaften geltend machen, Einwände, die, wie ja Habermas zugegeben hat, außerhalb der Argumentationspraxis liegen:
(a) Beziehungsmuster regeln immer schon unterschiedlich nach Motiven, Wünschen, Interessen, was als relevante Beiträge gelten könnten; Beziehungen wohnt mit anderen Worten von vornherein eine Tendenz zum Ausschluss subjektiver Relevanz inne – und damit bestenfalls die Aufforderung zur Toleranz und zum Akzeptieren von Unterschieden –, weil in einer wechselseitigen Abstimmung unterschiedlicher Individuen mit großer Andersartigkeit die Feststellung solcher Relevanz pragmatisch begrenzt werden muss. Dies gilt symbolisch, insbesondere aber auch imaginär.
(b) In Beziehungen haben Menschen aufgrund unterschiedlicher Voraussetzungen (z.B. alt oder jung, erfahren oder unerfahren, gebildet oder ungebildet, erfolgreich oder erfolglos usw.) nie die gleichen Chancen, Beiträge ungeschmälert zu leisten.
(c) Die Beziehungsteilnehmer sagen nicht immer, was sie meinen, weil sie es entweder nicht wissen (es bleibt ihnen unbewusst) oder nicht wollen (sie täuschen und verdecken ihre Meinung).
(d) Es gibt keine zwangfreie Kommunikation in Beziehungen, weil bereits das Einlassen auf ein symbolisches Wahrnehmungs-, Denk- und Erfahrungssystem einen Zwang bedeutet, sich im Blick auf andere Menschen zu beherrschen.
Diese Einwände für die alltägliche Lebenspraxis wird auch Habermas nicht verleugnen. Aber sie sind nun gerade im Diskurs nicht gestattet, sofern dieser sich auf kommunikatives Handeln gründet.
Ich will zwei kritische Einwände gegen das Modell erheben. Der erste wendet sich dem Problem zu, dass die Menschen, die nach den vier Voraussetzungen argumentieren wollen und sollen, auch Menschen in Beziehungen sind. Wie kann ausgeschlossen werden, dass die Beziehungswirklichkeit sich problematisierend auf die vier Ausgangspunkte auch in Diskursen geltend macht? Dies kann nur dann ausgeschlossen werden, wenn die Beziehungen strikt begrenzt und kontrolliert werden. Dies ist ein unmenschliches Verfahren: Der ehrgeizige Wissenschaftler, der Karriere auf Kosten aller anderen machen will; der Narziss, der sich immer im Kreis von Anerkennungen spiegeln muss und der dafür auch bereit ist, andere zu täuschen; der beleidigte Verlierer, der seine Argumente auf Rache aufbaut; der frustrierte Ehemann, der sein Begehren auf das Besserwissertum gegenüber seinen Mitarbeitern auch in der Wissenschaft oder in Diskursen verlegt hat; dies alles und alle weiteren, unzähligen menschlichen Dramen auch in der wissenschaftlichen Argumentationswelt werden zurückgestellt, um ein Idealbild zu erhalten. Es ist ja nicht so, als könnten die Beziehungen außerhalb des wissenschaftlichen Idealbildes stehen, denn auch Wissenschaftler führen Beziehungen. Was aber bedeutet dann dieses Ideal? Ist es nicht eine große Selbsttäuschung, die sich gegen Kritik dadurch immunisiert, dass sie zur Erhaltung eines kognitiv-rationalen Konstrukts alles opfert, was Wissenschaft im Horizont von Beziehungen zeigt? In anderen Worten können wir auch sagen, dass die Lösung bei Habermas noch ganz in der Bedeutung einer Aufrichtung einer engen Beobachtungswelt (der Aufrichtung des Diskurses des Wissens) steht. Damit aber verliert er Anschluss an die Frage, inwieweit die menschlichen Beziehungen, die immer schon vorausgesetzt sind, wenn Wissenschaft stattfindet, nicht das schmale kognitiv-rationale Modell gefährden. Dies aber wird zunehmend eine Schlüsselfrage, um Motive und Begrenzungen auch des Wissenschaftssystems zu analysieren.
Der zweite Einwand betrifft die Unterscheidung von Diskurs und Beziehungen. Können Beziehungen nicht doch auch als Diskurs aufgefasst werden?
Sofern wir Fremdbeobachter zulassen, die sich mit anderen Beobachtern über Beziehungen verständigen, kann diese Argumentationspraxis durchaus als Diskurs aufgefasst werden. Diese Fremdbeobachter stehen dann allerdings vor einem Problem: Sie beobachten Menschen in Beziehungen, die selbst keinen Diskurs des Wissens führen, um deren Äußerungen sich und anderen Beobachtern dann als einen solchen Diskurs (z.B. über die soziale Interaktion) anzubieten. Wenn sie nun die Argumente nach Habermas einhalten wollen, so beschränken sie die Teilnahme derjenigen, die den Diskurs praktisch führen, denn die agierenden Personen werden in ihrem Diskurs nicht als Akteure gesehen, die relevante Beiträge persönlich einbringen könnten. Die Beiträge der Akteure sind immer die Beiträge der Fremdbeobachter. Selbst eine ausgeklügelte empirische Teilnehmerorientierung kann nicht verhindern, dass zumindest die Auswahl der Beobachtungen durch den Fremdbeobachter und seine Konstruktionen gesteuert wird. Die Relevanz wird allein aus ihrer Sicht vermittelt, auch wenn sie beispielsweise mittels teilnehmender Beobachtung und qualitativer Interviews so tun, als ob sie die Relevanz direkt vor Ort abrufen. Im strikten Sinne jedoch ist solche Relevanz erschlichen. Zunächst wird der Diskurs strikt auf einen Diskurs des Wissens beschränkt. Es bleibt nur die Frage: In welchem Diskurstyp sehen sich Selbstbeobachter in einem Diskurs, in welchem wird ihnen von Fremdbeobachtern ein Diskurs gestattet? Ist es folgerichtig, allein einen Diskurs des Wissens als ausschließlichen Diskurstyp anzuerkennen? Für den interaktionistischen Konstruktivismus ist dies nicht folgerichtig (vgl. Kapitel IV.4). Aber die reduktive Argumentationspraxis wird bei Habermas gar nicht weitreichend problematisiert:
(a) Welches sind die Bedingungen der Möglichkeit dafür, dass niemand, der einen relevanten Beitrag leisten könnte, ausgeschlossen bleibt? Wie weit reicht die Relevanz? Wie weit reichen die Teilnehmer? Habermas entwickelt keine Beobachtertheorie, die uns genauer verständlich machen kann, welche Personenkreise im Ideal kommunikativer Handlungen überhaupt so agieren können, wie er es vorschlägt.
(b) Eine gleiche Chance ist eine Unterstellung, die von den Qualitäten der Beobachter abstrahiert. Da aber immer unterschiedliche Beobachter mit unterschiedlichen Welt- und Qualitätsbildern agieren, geraten wir in ein konstruktivistisch nicht vertretbares Paradox: Wir müssen eine Gleichheit voraussetzen, wo wir keine erreichen können. Selbst die eindeutigste symbolische Formulierung erlaubt als Konstrukt bestimmter Beobachter nicht, für alle Beobachter die gleichen Chancen zu gewähren. Das kann Habermas auch gar nicht meinen, denn die wissenschaftliche Argumentationspraxis ist eine strikt ausschließende, weil sie jenseits aller Partikularitäten im mindesten eine umfassende Bildung voraussetzt, um überhaupt die weitreichenden Argumente zu erfassen.
(c) Selbst- und Fremdtäuschungen sind Beobachterkonstrukte. Es ist nie auszuschließen, dass der letzte Beobachter, der eine Täuschung entlarvt oder vermieden hat, nicht noch von einem Beobachter hinter ihm damit überrascht wird, worin er sich täuschte.
(d) Zwänge sind bereits Bestandteil eines kulturellen Hintergrundkonsenses, der zwar mannigfach variiert, aber weder innerlich noch äußerlich vollständig distanziert werden kann.
Gegenüber diesen Problemen bleibt das Modell von Habermas geschlossen. Es trägt wenig Lebensnähe in sich. Blicken wir aus dem Mikrokosmos von Beziehungen, dann wird die Unmöglichkeit des Modells für die Beziehungswirklichkeit schnell deutlich. In diesen dominiert schließlich das, was auch Habermas zugesteht: Die absolute Unterschiedlichkeit trotz vieler Gemeinsamkeiten, die Singularität von Individuen und individuellen Ereignissen. Hinzu kommt, dass der Begriff der Gemeinschaft in der Beziehungswirklichkeit eine sehr schillernde und uneindeutige Position gewinnt. Als Gemeinschaften erscheinen sehr unterschiedliche, oft gegensätzliche und unvereinbare Bündnisse auf Zeit – gleichzeitig oder ungleichzeitig –, die einen ambivalenten, widersprüchlichen Bezugskreis von Konsensbildungen darstellen. Die Aufweichung traditionaler Moralvorstellungen hat in der Postmoderne geradezu zu einer Inflation der Widersprüche und des anerkannten widersprüchlichen Verhaltens von Menschen geführt, die mit dieser neuen Rolle kokettieren und spielen. Unter dem Blickwinkel des Zusammenlebens und der Sozialisation unterschiedlicher Menschen gilt der kommunikative Anspruch allenfalls soweit, wie er rechtlich, normativ, moralisch, in institutioneller Form abgesichert werden kann. Hier erscheint nur ein begrenztes gemeinschaftliches oder herrschaftsfreies Wollen und ein recht formal reguliertes, auf Gleichbehandlung ausgerichtetes Sollen, wenn wir kritische Gegenwartsanalysen betreiben. Und dafür liefert Habermas selbst sehr schlüssige Belege (vgl. etwa Habermas 1979, 1985, 1992, 1997).
Aus der Praxis der Lebenswelt kann sich so die Unterscheidung zwischen kommunikativem und strategischem Handeln allenfalls so konkretisieren, dass sie als Beobachterkonstrukt zur kritischen Reflexion von idealtypisch gedachten Mangelzuständen (Defiziten an Aufklärung, an Gleichheit) herangezogen wird. Das impliziert einen Wechsel von einem Geltungsanspruch zu einem bloßen Beobachterkonstrukt, das allerdings in seinem sozialhistorischen und kulturellen Kontext gesehen werden muss. Vielleicht erinnern wir uns in unseren Handlungen an die idealtypische Unterscheidung von kommunikativem und strategischem Handeln, wenn wir uns wieder einmal in Strategiespielen beobachten, um die Unwahrscheinlichkeit des kommunikativen Handelns zu erkennen und als Mangel unserer Situation zu betonen. Damit aber gewinnen wir ein neues Verständnis. Das kommunikative Handeln im Sinne von Habermas könnte als Beobachterkonstrukt als eine Norm zu einem besseren Handeln im Sinne bestimmter gesellschaftlicher Forderungen an eine relative Herrschaftsfreiheit von Handlungen verstanden werden. Soweit politische, ökonomische und soziale Herrschaftsverhältnisse angesprochen sind, in denen die in unserer Zeit sinnvoll erscheinenden Menschenrechte verweigert oder nicht umfassend genug realisiert werden, scheint dieses Konstrukt gesellschaftlich wünschenswert.
Insoweit nimmt Habermas durchaus einen relevanten Platz in einer konstruktivistischen Reflexion ein. Was würde es bedeuten, wenn wir seine Position konsequent auf die Beziehungswirklichkeit übertragen? Voraussetzung dafür wäre es, sie in einen Diskurs über Beziehungen in einer Lebenswelt umzusetzen. Ich sehe drei Möglichkeiten:
(1) Wir könnten versuchen, Beziehungen nach diesem Muster diskursiv zu rekonstruieren. Wir müssten dann am Beispiel von konkreten lebensweltlichen Beziehungen zeigen, wie sich dieser Anspruch bestätigen oder widerlegen ließe. Dabei befinden wir uns in einem ständigen Selbstversuch: Können wir für unseren Beziehungsalltag den gesetzten Maßstab bestätigen oder widerlegen?
Greifen wir auf Aussagen von Beziehungstherapeuten zurück, die sich gezielt mit Beziehungen beschäftigen, dann wird die Antwort ernüchternd ausfallen. Beziehungen sind nun gerade nicht ein Ort, wo überwiegend kommunikativ-rational gehandelt wird. Selbst bei einem Versuch, das zu beschreiben, was Habermas als Zurechnungsfähigkeit in einer Kultur und einem Rationalitätsstandard bezeichnet, werden wir bei näherer Hinsicht grundlegend in unseren eigenen Standardisierungen verunsichert. Es ist ja gerade die Vernunft, die Habermas verteidigen will, die sich die Unvernunft erschaffen hat (vgl. Foucault 1973). Insoweit entfaltet Habermas immer nur eine Seite dieser Vernunft: ihre Selbstbezüglichkeit. Sucht er zudem mit Piaget oder Kohlberg nach allgemeinen, konstruktiven Entwicklungsphasen nicht nur der Kindheit, sondern übertragt dieses Modell auf die gesamte Menschheit, dann gerät er in die Rolle eines letzten Beobachters, der sein Rekonstrukt übergeneralisiert. Das erzeugt zwar interessante Sprach- und Denkspiele, deren Beobachtungsrahmen wir jedoch präsent halten müssen, um nicht in zu starke Vereinfachungen zu geraten. Die Unschärfen der Beziehungswirklichkeit als Psychologik jedenfalls kann und soll das Modell gar nicht erfassen helfen.
(2) Effektiver scheint es mir, das Anliegen von Habermas dekonstruktivistisch zu nutzen. Die egalitären und symmetrischen Grundvoraussetzungen, die notwendig sind, einen Diskurs ohne Zwang zu führen und der Rationalität von Argumenten und nicht dem egoistischen Begehren zu gehorchen, erscheinen angesichts der strategisch organisierten Lebenswelt als Möglichkeit der Kritik. Solche Kritik markiert das nicht Erreichte (rekonstruktiv: das Unerreichbare), das zur Veränderung von Beziehungen eingesetzt werden kann. Als Dekonstruktion bleibt es die Mahnung des Beobachters Habermas, auf Kriterien zu achten, die das verletzen, was notwendig wäre, um Beziehungen demokratischer, gerechter, solidarischer zu führen. Das macht auch die Stärke von Habermas aus: Seine lebensweltlichen Analysen der Kultur bezeichnen sehr viel präziser solche beobachtbaren Defizite als das allgemeine Modell. In der Hinwendung zu politischen und rechtlichen Fragen ringt Habermas um eine Präzisierung von Argumenten, die uns eine gerechtere Zukunft zeigen.
(3) Am effektivsten aber wäre es, die Position von Habermas aus ihrer Rekonstruktion heraus in eine Konstruktion zu wenden. Sie müsste dann als ein gesellschaftlicher Kampfbegriff und -platz entfaltet werden, der die ihr eigene Weltfremdheit als Abstraktion überwindet. Dann stellt sich die Beobachterposition von Habermas als ein normatives Konzept heraus, das im Bereich der gegenwärtigen Rationalitätsdebatten von jenen Verständigungsgemeinschaften eingesetzt werden könnte, die die Gefahren einer Übermacht eines ökonomischen, politischen, gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen Ungleichgewichts zwischen Menschen entfaltet sehen und hierzu Gegenmaßnahmen ergreifen wollen.
Allerdings verweist dieser letzte Punkt uns auf ein besonderes Dilemma. Als Beobachter von außen scheinen wir Entscheidungen und Vorgaben zu treffen, die die Menschen in Beziehungen dann realisieren sollen. Das erscheint als unwahrscheinlich. Erst wenn aus dem Druck der Beziehungswirklichkeit und Lebenswelt heraus, aus dem Anliegen von größeren Menschengruppen die Relevanz einer solchen Konstruktion eingesehen und gelebt werden könnte, ließe sich der konstruktive Rahmen entfalten, der bei Habermas als Geltungsanspruch modellhaft allein auf der symbolischen Ebene entwickelt wird.
Die damit vorgenommene Umdeutung scheint mir für die Beziehungswirklichkeiten in der Lebenswelt angemessener zu sein, als die abgehobene Behauptung eines Diskursstandards, der die Rolle der Praxis und darin Macht in Beziehungen unterschätzt. Er verliert im Konstruktivismus seinen Absolutheitsanspruch und wird zu einem Ansatz neben anderen. Gleichwohl können wir trotz des Verlustes der Universalisierung uns um eine Umsetzung bemühen, weil die Vorschläge von Habermas sich mit Erfordernissen einer Demokratisierung von Beziehungen decken, die Beobachtervielfalt und -offenheit in Beziehungen sichert. Dies gilt, insofern Verständigungsgemeinschaften von Beobachtern dies für sinnvoll halten. Als Beobachter unserer Kultur treten interaktionistische Konstruktivisten z.B. für folgende Normen ein:
- Die Anerkennung der Andersartigkeit des Anderen. Diese konkurriert allerdings mit einer verallgemeinerten Perspektivenübernahme, die als Selbstbeherrschungsleistung (Selbstzwang) abverlangt wird und einen Fremdzwang für das Individuum durch die Gemeinschaft darstellt. Habermas sieht hier, dass sich die Teilnehmer solcher Verständigung für Revisionen ihrer Selbst- und Fremdbeschreibungen offenhalten müssen (Habermas 1997, 60). Habermas begrenzt dies auf eine rationale Anerkennungsverständigung. Ich denke, dass diese Perspektive eine grundsätzliche dekonstruktivistische Einstellung bei verallgemeinerten Perspektivenübernahmen erforderlich macht. Und hier radikalisiert und überwindet der interaktionistische Konstruktivismus die Position von Habermas, weil dieser Aspekt immer auch eine Hinwendung zu Objekt-, Macht- und Beziehungsfallen einschließt, die durch keine rational-kognitive Prozedur von Verständigung herrschaftsfrei und allgemein geregelt oder beseitigt werden können. Die Anerkennung der Andersartigkeit des Anderen schließt zudem immer auch seine imaginäre Seite ein, die über das Begehren die rationalen Konstrukte subvertiert.
- Das Zulassen unterschiedlicher Interessen- und Wertlagen von Individuen, was Offenheit erst herstellen hilft. Dabei eine Zwanglosigkeit der Begegnung unter möglichst hoher Freiheit. Dies bedeutet allerdings, dass der beste und letzte Beobachter verschwindet (vgl. Kapitel III.2.6).
- Die Förderung argumentativer Diskurse und ihre vertiefende Umsetzung in die kulturelle Lebenspraxis. Aber genau dies erscheint als immer unwahrscheinlicher. Eine Bildungsoffensive mit der Notwendigkeit umfangreicher Lehre von Diskursen ist heute immer weniger erkennbar. Damit aber minimieren sich Chancen einer diskursiven Verständigung, sich Re/De/Konstrukte reflektiert anzueignen. In diesem Kontext ist die Aneignung auch der Diskurstheorie von Habermas sinnvoll. Ein eigener Entwurf einer konstruktivistischen Diskurstheorie erfasst diesen Sinn insbesondere im „Diskurs des Wissens“ und in „Mindestanforderungen an ein konstruktivistisches Lebensweltmodell“ (vgl. Kap. IV.4).
- Schließlich aber auch die Anerkennung des Umstands, dass Lösungen in lebensweltlichen Beziehungen immer aus den Ressourcen dieser Beziehungen selbst hervorgehen. Es gibt allenfalls ein abstrahiertes kognitiv-rationales Kriterium für ein herrschaftsfreies kommunikatives Handeln, aber dies erscheint weder als sehr weit verbreitet in den Beziehungen der Alltagswelt noch als umfassend wirksam. Selbst im engeren Bezugskreis und Horizont jener Wissenschaftler, die eine Beziehung nach dem Modell kommunikativen Handelns führen sollten, sehe ich kaum eine Annäherung an das Ziel. Dies liegt wohl an der symbolischen Eindimensionalität des Modells selbst. Erst wenn sie in das imaginäre Begehren eingefügt werden könnte – in der Studentenbewegung waren davon Ansätze zu spüren –, kann mit einer radikaleren Umsetzung in die Lebenspraxis gerechnet werden. Doch im Gegensatz zur Studentenbewegung müsste die Bewegung dann auch noch von allen gleich immer schon anerkannt und vorausgesetzt sein, um nicht in ein Gegenteil der Unterdrückung bestimmter anderer Gruppen umzuschlagen. Genau dies aber verweigern die gegenwärtigen Beziehungs- und Lebenswirklichkeiten als Multikulturalität und postmodernes Stückwerk. So bleibt die Theorie von Habermas für mich in erster Linie ein Stück Trauerarbeit über einen Verlust an tragfähigen Vorbedingungen von Verständigung: Nach Habermas treten wir in die Ambivalenzen der Postmoderne und eine Trauerarbeit an den Aufklärungsidealen ein.
3.3.2.3. Transversale Vernunft als Rettung?
Wolfgang Welsch (1995) hat eine umfassende Studie zur zeitgenössischen Vernunftkritik vorgelegt, die in einer systematischen Auseinandersetzung mit Vernunftkonzepten im pluralen Widerstreit als eine gute Ergänzung der hier vorgelegten Analyse von Kränkungsbewegungen (Band 1) gelesen werden kann. Welsch arbeitet deutlich heraus, dass der Widerstreit zwischen den Vernunftansätzen nicht mehr durch die Rückkehr zu einem Ansatz, nicht durch die Bevorrechtigung eines bestimmten Vernunftkonzeptes gelöst werden kann. Die Kränkungen, so das Fazit auch seiner Untersuchung, sind zu groß geworden.
Gleichwohl entsteht dann die Frage, was wir als Beobachter einer solchen Vernunftentwicklung uns noch als letzte Vernünftigkeit aufrechterhalten wollen. Dabei sieht Welsch zwei wesentliche Voraussetzungen, die die Pluralisierung ausmachen:
Erstens: „Die ehedem eine Vernunft ist modern in eine Mehrzahl eigensinniger Rationalitäten auseinandergetreten.“ (Ebd., 441) Darin zeigt sich eine erste Pluralisierung, die sich vor allem durch ein Nebeneinander – eine Ausdifferenzierung – von wissenschaftlichen Sichtweisen (z.B. Fächerdifferenzierung) ausdrückt.
Zweitens: Gegenüber dem „schiedlich-friedlichen Nebeneinander der ausdifferenzierten Rationalitätsbereiche“ kommt es in der eigentlichen Pluralisierungsphase zu einer simultanen Konkurrenz unterschiedlicher, sich bekämpfender wissenschaftlicher Paradigmen.
Welsch bemüht sich nun in dieser vernunftimmanenten Deutung, sich doch noch einen Rest an gemeinsamer, an transversaler Vernunft zu rekonstruieren. Doch ist der erste Deutungsschritt einer schiedlich-friedlichen Pluralisierungsphase im bloßen Nebeneinander überhaupt zutreffend?
Welsch fehlt ein Beobachtermodell zur Situierung von Vernunftkonzepten. So ist er verleitet, eine idealtypische Entwicklung der Vernunft zu unterstellen, für die es aber gar keinen hinreichenden Beleg gibt. Die erste Pluralisierungsphase ist genauso ein Beobachterkonstrukt wie die zweite.
Im Grunde erkennt Welsch dies an, wenn er rationale Standardangebote, die seit Kant immer wieder unterbreitet werden – nämlich die Unterscheidung einer kognitiven, moralisch-praktischen und ästhetischen Rationalität – als in sich durchaus unklar, uneindeutig und offen dekonstruiert. Aber gilt solche Dekonstruktion nicht auch schon für jede Vorphase einer Vernunft, die wir als eine Einheit der Vernunft an einem Ursprungsort uns definieren wollen? Wie sollen wir denn anders als durch Ausschluss uns jene Beobachter festlegen, die von einer ersten, vermeintlich einheitlichen Vernunft künden? Zudem sitzen wir immer schon in der Falle, dass wir so ohnehin nur das, was wir als vermeintlich vernünftige Beobachter für vernünftig halten, in der Vernunftgeschichte uns rekonstruieren werden.
Nun bleibt Welsch, so denke ich, methodologisch mitunter unklar, weil er die Beobachterrolle bei der Bestimmung einer übergreifenden, pluralen Vernunft nicht hinreichend entwickelt. Vernunft ist für ihn als transversale Vernunft eine Vernunft der Übergänge. Sie muss „Heterogenität und Verflechtung, Pluralität und Übergang“ zusammen denken können (ebd., 761 f.). Und dabei unterstellt er, dass die Vernunft eben auch nicht in reiner Pluralität, also außerhalb einer gewissen Verflechtung, gelebt werden kann. „Sie muss sich ins Geflecht der Rationalitäten hineinbegeben, andernfalls hätte sie weder Gegenstände noch Sicht. Transversale Vernunft ist, von den Rationalitäten aus gesehen, nötig, um zwischen deren diversen Formen Austausch und Konkurrenz, Kommunikation und Korrektur, Anerkennung und Gerechtigkeit zu ermöglichen“ (ebd., 762). Doch welcher Beobachter soll diese Transversalität, die sich ja meist erst aus einem Vergleich verschiedener Beobachtungen und symbolischer Lösungen durch weitere Beobachter ergibt, sichern? Ist die These von Welsch als eine Art Metatheorie der Vernunft für alle Theorien im Sinne eines Appells oder Prinzips („sorge dafür, dass ...“) gemeint oder soll sie gar eine Beschreibung einer vorhandenen, hinter dem Rücken der widerstreitenden Theorien bereits wirkenden, alle Teilnahmen und Teilnehmer bestimmenden Vernunftweise gelten?
Für die Metatheorie spricht, dass Welsch der transversalen Vernunft die Aufgabe zuweist, eine „Analyse, Prüfung und Korrektur der Rationalitäten“ vorzunehmen, ohne dabei selbst „fertig mitgebrachte Prinzipien“ zum Einsatz zu bringen. Doch der damit erzeugte Widerspruch ist offensichtlich: Wie soll ein bestimmter Beobachter analysieren, prüfen und korrigieren, wenn er nicht bereits mittels ausschließender, grundrisshafter, vorentschiedener Perspektive – also von ihm gesetzten Teilnahmebedingungen – vorgeht? Wie kann überhaupt eine möglichst offene, auf Übergänge und Pluralität bedachte transversale Vernunft als ein übergreifendes Vernunftkonzept entwickelt werden?
Eine Lösung scheint ein Methodenkatalog zu sein, der jedem, der postmodern Vernunft praktizieren will, bestimmte Prinzipien (also doch einen vorgefertigten Grundriss) auferlegt. Auf ihren Kern reduziert lauten die Empfehlungen (ebd., 694 ff.):
(1) Analysiere die einzelnen Paradigmen genau, finde ihren zentralen Punkt heraus, ihre Grundoptionen, die radikal den eigenen Ansatz markieren.
(2) Vergleiche einzelne Paradigmen mit anderen ihrer Sphäre. Arbeite Differenzen und Gemeinsamkeiten heraus.
(3) Untersuche die tiefer liegenden Verflechtungen, die Paradigmen miteinander verbinden. Zeige eine Gesamtarchitektur, die das einzelne Paradigma sich verbirgt.
(4) Untersuche transparadigmatische bzw. transsektorielle Optionen und damit verbundene Probleme und Unschärfen von Paradigmen. Scheue dabei nicht, dass diese Arbeit unbeendbar und unordentlich erscheinen wird.
(5) Untersuche Optionen von Paradigmennetzen wie in (4).
(6) Frage nach dem Ganzen, das ein Paradigmenverband ausdrücken will. Suche die Perspektive auf, aus der das Ganze aus der Sicht von Paradigmenverbänden zum Ausdruck gebracht wird. Zeige die Charakteristika und deute die unterschiedlichen Bilder.
(7) Vergleiche die Bilder miteinander. Suche wiederum Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Spiele das eine Problem aus den Blickwinkeln verschiedener Perspektiven durch. Wähle dazu bewusst auch abseitige oder entlegen scheinende Probleme, da an ihnen Grundoptionen und Eigenarten von Paradigmen besonders deutlich werden.
(8) Wie sieht nun das Ganze angesichts der bisher herausgestellten Gemeinsamkeiten und Unterschiede aus? Untersuche das Gegenspiel, bestimme, warum alles nicht mehr zu einer Einheit zusammenpasst. Scheue erneut nicht die Unüberschaubarkeit und Unordnung. Übe eine klare, nüchterne, vernünftige Reflexion. Mache die Polyperspektivität zu deiner Sache.
(9) Wende dich nun den Paradigmen wieder zu und gib ihnen eine angemessene, der Komplexität entsprechende, Form. Befreie sie von ihren Beschränktheiten, ihrer verengten Sicht ebenso wie ihrer Selbstüberschätzung, und gib ihnen eine mit den anderen Paradigmen verträgliche Form, eine Form der möglichen Koexistenz und Pluralität.
(10) Praktiziere die umgedeuteten Paradigmen nunmehr in der Form dieser Umdeutung. Praktiziere eine weite Form der Vernunft, wobei du auch Ausschlüsse und Kehrseiten von Paradigmen beachten musst.
(11) Bemerke stets Unklarheiten und Unsicherheiten, die bleiben. Oft deuten sie auf besonders fruchtbare Entwicklungspunkte. Beachte Neukombinationen und Veränderungen. Übe nicht nur Genauigkeit, sondern sei auch kreativ und fantasievoll im Erfinden neuer Möglichkeiten.
(12) „Bedenke schließlich, was diese Vernunft für ein merkwürdiges und polyvalentes Vermögen ist und wie sie alle ihre Leistungen in Übergängen vollbringt.“ (Ebd., 696)
Beziehen wir in diese 12 Punkte stets den Beobachter ein, und sehen wir, dass alle paradigmatischen Bemühungen Re/De/Konstruktionen von Wirklichkeiten sind, dann decken sich die methodischen Empfehlungen von Welsch mit Einstellungen des interaktionistischen Konstruktivismus. Allerdings thematisiert Welsch überwiegend die kognitiv-rationale Seite in seinem Methodenkatalog. Er unterschätzt das Imaginäre, da er es nur als Ausdruck einer Vernunft sieht: „Praktiziere eine Vernunft, die Präzision mit Fantasie und Erfindungskraft verbindet.“ (Ebd.) Der interaktionistische Konstruktivismus sieht auch die Kehrseite: Das Imaginäre subervertiert oft genug die scheinbar präzise praktizierte Vernunft. Das Reale schließlich erweist sich als Grenzbedingung aller Vernunftoptionen.
Die methodischen Empfehlungen lesen sich allerdings noch nicht als strenge Anleitung einer transversalen Vernunft. Sie markieren nur Wunschvorstellungen und Regeln, die als Empfehlungen keine nicht hintergehbaren Gründe für eine neue Verallgemeinerung bieten. Man kann sie sinnvoll in einer Verständigungsgemeinschaft, die den Fokus auf plurales Wissen legen will, befolgen; sie werden dort auch ertragreich sein können. Aber man muss es in einem strikten, nicht hintergehbaren Sinne eigentlich nicht immer verbindlich tun. Sie gebieten nicht mehr eine unabänderliche Einheit für alle Ansätze, dass sie nur dieser Vernunft als eine ihrer Möglichkeiten folgen müssen, um vernünftig zu sein. Wir sehen in der Wissenschaftspraxis sogar eher, dass sie kaum befolgt werden.
Nun schwankt aber Welsch eigentümlich und kehrt teilweise doch zu einem nicht hintergehbaren Motiv der Vernunft zurück. Denn seine Behauptung einer transversalen Vernunft weist ihr eine Struktur zu. Die Strukturen dieser Vernunft „sind nicht inhaltlicher Natur (was allein die apriorische Festlegung von Gebieten, Grenzen, Aufbauverhältnissen usw. erlauben würde), sondern strikt formaler Art.“ (Ebd., 764) Aber welche formale Logik soll nunmehr über alle Beobachter gebieten?
Hier fällt Welsch in die Fallen einer idealtypischen Generalisierung zurück, die letztlich doch wieder auf eine Einheit der Vernunft zurückführt. Es entsteht eine eigentümliche Vernunft: Sie erscheint als rein, sofern sie ohne imperiale Gesten „zu konkreten Klärungen und überlegten Entscheidungen im Feld der Rationalität fähig“ ist (ebd.). Sie muss dann eine Vernunft der Übergänge sein, wie es die methodischen Regeln fordern. „Prinzipienlosigkeit, Formalität, logischer Charakter, Reinheit, Reflexionstätigkeit, operationale Effizienz und Übergangsfähigkeit der Vernunft gehören zusammen.“ (Ebd.) Es ist für Welsch eine Vernunft der Bewegung. Sie ist die Auflösung von separatistischen Denkweisen, sie zwingt uns, Übergänge anzuerkennen. Dies dokumentiert sich vor allem durch die Anforderungen der heutigen Lebenswelt, die uns ständig zwingt, neue Sichtweisen einzunehmen (vgl. ebd., 775). Die alten, großen Metaerzählungen zerfallen, die ehemals starken Begriffe der Theorie, der Wahrheit und des Systems werden weich. All dies sind aus der ersten Kränkungsbewegung uns vertraute Sachverhalte, die Welsch ebenfalls systematisch aufbereitet und begründet.
Dies betrifft sowohl kulturelle als auch subjektive Horizonte (vgl. ebd., 829 ff.). Welsch deutet auch das interaktionistische Grundproblem der Subjektivität an (ebd., 849), ohne es jedoch zu einem systematischen Ausgangspunkt seiner Theorie zu machen. Insbesondere entgeht ihm die imaginäre Seite der Transversalität, die die vernünftige Seite relativiert. Und dennoch ist es interessant, wie er zumindest für die kognitiv-rationale Seite den Spannungsbogen aufbaut, der die plurale Vernunft in ihrer Heterogenität breit und differenziert entfaltet, um sie am Ende in einer Argumentation des Heterogenen als ein Gebot von transversaler Vernunft zu zeigen. Müssen wir nicht mindestens, so lautet die Wendung, im Dissens noch eine Form der Verständigung wahren? Diese Implikation verweist insbesondere auf das Anliegen der Transzendentalpragmatik. Inwiefern kann die transversale Vernunft damit nicht nur zeitbezogene Übergänge markieren helfen, sondern auch eine generalisierende Perspektive und generelle Erwartungen an die Vernunft einnehmen? „Weitsicht, Ganzheitsbezug, Entscheidungskompetenz, Eröffnungscharakter, Transparenz, Spezifikationsvermögen, Grenzgängerschaft und Souveränität“ (ebd., 909), dies sind wesentliche Anforderungen an eine solche Generalisierbarkeit für Welsch.
Damit wird offensichtlich, dass er eine Rationalität vor Augen hat, die eine Vielzahl von divergierenden Perspektiven ins Auge fasst, gleichzeitig aber in ein neues Ganzes ausgreift (ebd.). Welsch behauptet kühn: „Sie erweist sich dabei als Anwalt von Gerechtigkeit inmitten der Vielheit.“ (Ebd.) Gleichzeitig soll sie stets offen für neue Perspektiven, für Kritik, Transparenz usw. sein, was alles sehr idealtypisch konstruiert wird. Welsch fehlt ein Bild des Beobachters, der solche Leistungen überhaupt konkret nach Interessen- und Machtlage realisieren könnte. Er fixiert sich ausschließlich auf ein abstraktes Bild von Vernunft, das geradezu übermenschlich regiert. Dabei sind es nüchtern betrachtet bloß Konstruktionen eines Autors, der sich Verständigungsgemeinschaften wünscht, die nach bestimmten pragmatisch und sinnvoll erscheinenden Vernunftüberlegungen (ethnozentrisch aus einer westlichen Kultur heraus gedacht und postmodern gedeutet) verfahren soll. Die Fixierung auf Gerechtigkeit ist dabei ein aktuelles Konstrukt in dieser Kultur (vgl. Brumlik/Brunkhorst 1993).
Welsch gesteht ein, dass er „fahrlässig offen“ ist, wenn er behauptet, dass die transversale Vernunft eine Vernunft überhaupt unter gegenwärtigen Bedingungen sein solle (ebd., 910). Und dann kommt ein Satz, der eigentlich nach der zuvor sehr differenzierten Analyse der Postmoderne und von Autoren, die die unterstellte Einheit von Vernunft dekonstruieren, unverständlich ist: „Andererseits weiß jeder, dass es unvermeidlich ist, Aussagen zu machen, die generelle bzw. universelle Geltung beanspruchen.“ (Ebd., 911) Wer diese Aussage nicht akzeptiert, der wird von Welsch eines performativen Widerspruchs bezichtigt, der darin besteht, dass man in der Verteidigung des eigenen Ansatzes doch stets diese Geltung unterstellt, die man zu bestreiten meint.
Der Satz ist aus interaktionistisch-konstruktiver Sicht in mehrfacher Hinsicht zu kritisieren. Zunächst wird ein universalisiertes Wissen unterstellt, das zurückgewiesen werden kann. „Jeder weiß“ mit Sicherheit nicht, welche Unvermeidlichkeit hier herrschen soll. Die Behauptung von Welsch diskriminiert viele der zuvor von ihm analysierten und dargestellten Ansätze, ohne hinreichend Argumente gegen sie vorzutragen. Welsch begründet eine übergreifende, generelle und universelle Vernunft als transversale Vernunft im Grunde nur dadurch, dass die Vernunft (offenbar von ihrem Ursprung her) zu einer Einheit zwinge, auch wenn diese Einheit die Anerkennung von Vielheit sei. So stellt er die Vielheit unter eine Perspektive des Selben, was einmal mehr den von Levinas bezeichneten Fehler abendländischer Philosophie ausdrückt, die den Anderen nicht als Anderen erträgt. Er beschränkt die Aussage zudem auf ein Wissen, d.h. er trägt sie rationalistisch verkürzt vor. Ich sehe die Kränkungsbewegungen der Vernunft viel weiter. Ich sehe, dass sie durch Interaktion und Unbewusstheit viel weiträumiger in der Unterstellung einer Generalisierbarkeit unterhöhlt ist, als es der Diskurs des Wissens ausdrückt.
Doch bleiben wir im rationalen Bestimmungsdiskurs. Welsch unterstellt in seinem Zitat, dass es eine Verständigungsgemeinschaft gibt, in der alle Pluralität als Pluralität aufgehoben ist. Nur so kann er plurales Wissen unter die eine Verständigung von Generalisierbarkeit bringen bzw. eine universelle Geltung transversaler Vernunft bestimmen. Aber genau dies abstrahiert nun von unterschiedlichen Beobachtern, Teilnehmern und Akteuren, die sich bezüglich ihrer Verständigungsgemeinschaften orientieren und situieren. Sie sind immer schon in einer Verständigungsgemeinschaft oder spezifischen Übergängen und Teilmengen bestimmter Verständigungsgemeinschaften gefangen. Was soll dann eine generelle Geltungsgemeinschaft sein? Es müsste ja offenbar eine sein, in der auch der spezifische, eigensinnige, egoistische usw. Ansatz mit aufgeht. Welsch behauptet: „Jede Form von Vernunft – auch jede historische Form – ist gehalten, eine Vielheit in einer einheitlichen Sicht zu verbinden.“ (Ebd., 912) Diese Einheit ist zwar nicht mehr inhaltlich möglich, aber sie ist es für Welsch formal. Damit bezeichnet transversale Vernunft „die Grundform von Vernunft überhaupt“ (ebd., 915).
Unter dieser vereinheitlichenden Sicht erscheint eine Selbstreferenzialität auch von Pluralitätskonzeptionen. Dies gilt für Welsch in zweierlei Hinsicht: „Die Pluralitätskonzeption wird den Forderungen, die sie an andere Konzeptionen stellt, auch selbst, sie wird ihnen in ihren eigenen Aussagen genügen müssen. Zweitens wird sie, performativ betrachtet, ihre eigenen Prinzipien auch in ihrem Vorgehen verkörpern müssen.“ (Ebd., 924)
Der interaktionistische Konstruktivismus teilt diesen Denkschritt nicht. Erstens können wir keine generellen Forderungen an andere Theorien oder eine zugelassene Bandbreite von Kritik in universalistischer Absicht erstellen. Dies heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass der Konstruktivismus alles nur relativ oder beliebig sieht. Auch interaktionistische Konstruktivisten gehen von bestimmten Perspektiven aus, die sie mit ihrer Verständigungsgemeinschaft teilen. Doch dieses Teilen bedeutet nicht, dass sie alle anderen Ansätze auch teilen müssen. Pluralität bedeutet vielmehr, dass es keine einheitliche Vernunft des Pluralen selbst mehr gibt, weil Grenzen des Teilens vorhanden sind. Der Dissens muss als Dissens möglich bleiben, und dies reicht bis hin zu einer Unüberbrückbarkeit von normativen Vorstellungen. Selbst wenn wir uns in unseren Grenzen sehen, so bedeutet dies nicht zugleich, dass wir uns in ihnen auch noch und immer mit allen Anderen verständigen können. Eine allgemeine Verständigung kann nicht theoretisch durch universelle Geltungsnormen hergestellt werden, sondern erweist sich in den Praktiken, Routinen und Institutionen einer Lebenswelt, die den gesetzten Anspruch stets subvertiert und durch hegemoniale Machtkämpfe entscheidet. Insoweit gibt es als Selbstreferenz nur eine systemimmanente konstruktivistische Referenz, mit der sich andere Ansätze auseinandersetzen können, so wie andere Ansätze ihre eigene Referenz tragen. Pluralität selbst ist eine Beobachterkategorie, die Unterschiede markiert. Dabei ist zu beachten, dass der gesellschaftliche Rahmen erst in Formen der Demokratie, ein solches Nach- und Nebeneinander von Ansätzen überhaupt gestattet, es also einen gesellschaftlichen Teilnahmerahmen an solcher Freiheit, Widersprüchlichkeit und Ambivalenz gibt. Dieser Rahmen ist umkämpft und selbst in Entwicklung begriffen, den Kämpfen der Beteiligten ausgesetzt. Würden wir diesen Rahmen formal philosophisch fixieren und universalisieren, dann wechseln wir von gesellschaftlich-historischen Prozessen in ein Vernunftkalkül, dass diese Widersprüchlichkeit und Ambivalenz nicht hinreichend auffangen könnte.
Zweitens gibt es für den Konstruktivismus dabei keinen performativen Selbstwiderspruch, weil er anderen Beobachtern erst gar nicht sein Modell von Welt als generelle Sicht aufzwingt. Es ist unmöglich für den Konstruktivismus, andere Ansätze eindeutig über die Richtigkeit und Wahrheit nur noch einer geltenden Vernunft, Norm, Perspektive usw. zu kontrollieren. Dies bedeutet aber nun auch wiederum nicht, dass alle Ansprüche an die Vernunft, Normen, Perspektiven usw. beliebig oder nur noch relativ werden. Sie sind Konstruktionen, die von einer Verständigungsgemeinschaft im Widerstreit in die Lebenswelt eingebracht werden. Pluralität ist hier immer ein Kampfbegriff und kein reines Vernunftkonzept, zu dem es Welsch machen möchte. In Übergängen zu solcher Vernunft sind immer auch Grenzen von Verständigung oder Verstehbarkeit enthalten. Sie sind dabei, wie die voraufgehenden Abschnitte gezeigt haben, immer in Interessen- und Machtstrukturen perspektivisch eingewoben, so dass die Formulierung einer Metatheorie einer Vernunft, die das Widersprüchliche und sich Widersprechende auch noch unter ein theoretisches Konzept stellen soll, als unmöglich erscheint.
Diese Unmöglichkeit gibt Welsch in Randbemerkungen auch durchaus zu. Gegenüber nicht-pluralistischen Sichtweisen mahnt er Auskunftspflichten an (sie sollten sich in eine Beobachterposition der Pluralität versetzen, weil heute doch jeder ein plurales Denken erkennen müsse). Die von Welsch geforderten Kriterien wissenschaftlich-vernünftiger Arbeit – vor allem „Vielheitsbeachtung, Spezifitätsbewusstsein, Alternativenanerkennung, Grenzbeachtung“ (ebd., 931) – sind gewiss wünschenswerte Einstellungen für alle wissenschaftlichen Ansätze. Fast jeder gegenwärtige Ansatz wird auch behaupten, dass er sie erfülle. Aber Welsch sieht nicht hinreichend, dass die Beobachter durch sein pragmatisches Gebot (beachte die Pluralität und ermögliche einen Konsens auch über den Dissens) immer überfordert sein werden. Auch die transversale Vernunft ist eine nicht hinreichende Vernunft gegenüber der Pluralität und der gegenwärtigen Unvermeidlichkeit von Dissens. Sie müsste als generalisierende Formalprozedur die Pluralität immer schon zerstören, bevor sie diese zur Geltung bringen kann. Auch eine höchst formale Prozedur des Feststellens von Auskünften und Diskussionsangeboten kann niemals frei von Konkurrenz verschiedener Auskünfte, unterschiedlich mächtig erscheinender Diskussionen, tatsächlich in der Lebenswelt sich durchsetzender und mit Karrieren verbundener Wirkungen sein. Der Dissens weist im Konsens von zugelassenen Verständigungsgemeinschaften auch wieder Grenzen auf, sofern konventionelle Gebote Grenzen und Ausschließungen setzen. Insoweit gibt es einen Dissens, über den vielleicht noch viele einen Konsens erzielen können; aber es gibt auch jenen Dissens, dem von einer Mehrheit oder Minderheit von unterschiedlichen Verständigungsgemeinschaften nicht zugestimmt werden kann. Die Andersartigkeit des Anderen ist eine stete Grenze, die an- und aufgegriffen wird, wenn wir dabei Grenz- und Ausschlussbedingungen für alle thematisieren wollen. Wir können diese nur als jeweilige Konstrukte bestimmter Verständigungsgemeinschaften re/de/konstruieren, wenn wir nicht in die traditionellen Fallen der Metaphysik zurückgeraten wollen.
Mit Foucault habe ich vor allem diskutiert, wie sich die neuzeitliche Vernunft als ausschließende und disziplinierende vollzieht. Welsch nimmt den Gedanken von Marquard (1981, 107 ff.) auf, der einer solch exklusiven Vernunft eine inklusive zur Seite stellt: Die Ausschluss-Vernunft muss durch eine Vernunft ersetzt werden, die sich auch dem zuwendet, was dem einzelnen nicht in den Kram passt. „Weite, Offenheit, Polyperspektivität, Umfassendheit“ (ebd., 939) werden so zu Ansprüchen einer transversalen Vernunft. Der interaktionistische Konstruktivismus kann diese Ansprüche teilen, aber er sieht sie nur in der Konzeption eines eigenständigen Ansatzes – also in der Konkurrenz mit unterschiedlichen Verständigungsgemeinschaften und in konkreten Aushandlungen mit je spezifischen Interessen – als realisierbar an. Dies gebietet für uns der Beobachter, der sich stets entscheiden muss, mittels welcher Ausschließungen er seine Perspektiven setzt und ausführt, die er sich als noch so weit, noch so offen, noch so variantenreich und umfassend vorstellen mag. Hinter und neben ihm stehen andere Beobachter, die dies dekonstruieren werden. Alle möglichen Beobachter nun auf ein formales Vernunftkonzept zu beziehen, macht aber wenig Sinn, weil es die Pluralität der Unterscheidungen durch das Gebot einer nicht herstellbaren und auch gar nicht wünschenswerten Einheit untergräbt. Warum fällt es uns so schwer, dies zu ertragen?
Im schlimmsten Fall bedeutet dies, dass auch der Konstruktivismus im Konkurrenzkampf abgelöst, vielleicht sogar vernichtet wird. Aber dieser Krieg ist der Krieg der Wissenschaftsgeschichte. Es ist kein illusorischer Frieden einer reinen Vernunft, der sich uns anbietet, sondern immer schon eine strategische Nutzung dieser Vernunft, die uns mahnt, die Vernunft als Maßstab nicht zu überschätzen. Diese Konsequenz habe ich aus Foucault abgeleitet.
Insoweit verzichtet der interaktionistische Konstruktivismus konsequent auf eine letzte, formale Vernunft. Was wir vielmehr betreiben, das ist eine Vernunftsetzung, die als konstruktivistische Eigenheiten gegenüber anderen aufweist (vgl. dazu z.B. die Konkretisierungen in Reich 2005, 2008, 2009). Die Besonderheiten, Ausschließungen und Grenzen als Eigenheiten bedingen eine Konkurrenz zu anderen Denkweisen. Die Generalisierbarkeit und Universalisierung von Theorien ist vorbei. Es lebe der konkrete Widerstreit. Dieser allerdings sollte, und da stimme ich Welsch uneingeschränkt zu, auch möglichst umfassend gelebt werden können. Pluralismus ist deshalb immer ein Kampfbegriff.
Aber was, so mag der in der Tradition stehende Philosoph einwenden, ist der Maßstab dieses Widerstreits? Wie wissen wir überhaupt davon, dass es sich um einen Streit handelt? Was ist die Vorverständigung, die wir voraussetzen müssen, um so mit Anderen konstruktivistisch zu argumentieren? Wenn wir nicht die Perspektiven von Beobachtern hätten, sondern ausschließlich aus einer Logik der Vernunft als einer universell beobachtenden Prozedur argumentieren würden, dann brächten uns diese Fragen in der Tat in große Schwierigkeiten. Aber der Konstruktivismus hat eine radikale Wendung vollzogen, die erkenntniskritisch sehr weitreichend ist. Gegenüber der Logik der Vernunft wird von uns ein Beobachter eingesetzt, der sich dieser Vernunft gegenüber in einer Selbst- oder Fremdreferenz – als Selbst- und Fremdbeobachter – verhalten kann. Die Situierung von Vernunft ist selbst schon ein Konstrukt. Dies hat wesentliche Folgen:
- Jede theoretische Position oder Option im Widerstreit pluraler Angebote hat ihre jeweils systemimmanenten Sichtweisen, die grundlegend für alles Beobachten und dabei für eine Konstruktion von Wirklichkeit und die Einsetzung bestimmter Wahrheiten sind. Diese Immanenz setzt Grenzen zu anderen Ansätzen. Sie beschreibt Regeln der eigenen Verständigungsgemeinschaft. Sie erzeugt eine Selbstreferenz, die den Selbstbeobachter hindern soll, sich anderen Sichtweisen zu öffnen. Der Ausschluss anderer Sicht- und Denkweisen ist für die eigene Position gewünscht, gewollt und notwendig.
- Übergänge zu anderen Sicht- und Denkweisen bleiben gleichwohl dann möglich, wenn Fremdbeobachterpositionen eingenommen werden können. Die Systemimmanenz muss bei einem anspruchsvollen, d.h. möglichst weitreichend begründeten Ansatz, immerhin gestatten, dass es auch Zugänge zu anderen Sicht- und Denkweisen geben kann. Entweder werden solche Zugänge als Abgrenzung genutzt (dies ist der Regelfall wissenschaftlicher Auseinandersetzungen, die den eigenen Ansatz durch eine Zunahme von Störerklärungen gegen jede Kritik letztlich immunisieren wollen), oder sie führen in eine systemtranszendente Perspektive ein, die die Begrenztheit der eigenen Position zu thematisieren versteht (dies ist der seltenere Fall einer Dekonstruktion eigener Begrenztheit). Der Konstruktivismus beansprucht beide Richtungen, weil eine abgrenzende Rekonstruktion nicht ausreicht, konstruktiv mit den Verflechtungen und Übergängen, die auch Welsch als lebensweltliche Perspektiven anmahnt, umzugehen. Die Dekonstruktion ist ein ideologiekritischer Selbstschutz, der den Konstruktivismus immer auch an die Grenze seiner Ausschließungen führt. Aber dies findet nur dann statt, wenn in einem etablierten Konstruktivismus der Dekonstruktivist als Beobachter tatsächlich zugelassen und beachtet wird. Da wir in lebensweltlichen Praktiken, Routinen und Institutionen stehen, kommt es hier weniger auf idealtypische Setzungen an, als vielmehr auf konkrete Untersuchungen von sich ereignenden Interesse- und Machtverbindungen, die das Dekonstruktive immer auch eindämmen und die Systemimmanenz fördern.
- Die Verständigungsgemeinschaft als Beziehungswirklichkeit und als symbolisch sich wechselseitig kontrollierende, normierende und disziplinierende Gemeinschaft reguliert die Selbst- und Fremdbeobachtungen und verhindert, dass eine transversale Vernunft als gelebte Pluralität überhaupt möglich werden kann. Allein eine Universalisierung der Verständigungsgemeinschaft wäre die Chance, eine übergreifende Vernunft als Macht- und Geltungsanspruch zu sichern. Aber diese Sicherung scheitert schon in rationalistischen Konzepten daran, dass die Objekt- und Machtfallen der Lebenswelt uns diese Möglichkeit bisher versagen. Würden sie nicht versagen, dann könnte eine universelle Verständigungsgemeinschaft andererseits ihren Konsens als totale Vernunft entfalten, was in ein universelles Dogma führen würde. Dies heißt nun aber nicht, dass unterschiedliche Verständigungsgemeinschaften heute nicht gut daran tun, ihre engen Horizonte zu erweitern und sich für Perspektiven von a/Anderen zu interessieren. Insbesondere eine transdisziplinäre Ausrichtung, die enge Fachgrenzen überwindet, eine interdisziplinäre Orientierung, die eine Zusammenarbeit herstellt, eine radikale Besinnung auf widerstreitende Ansätze, um vertiefende Analysen aus sehr unterschiedlichen Sichten (möglichst mit Vertretern dieser Sichtweisen im konkreten Dialog) zu ermöglichen, sind wünschenswerte, wenngleich im Wissenschaftsbetrieb noch äußerst seltene Möglichkeiten, Verständigungsleistungen zu erhöhen und Diskussions- und Auswahlmöglichkeiten überhaupt zu eröffnen. Aber es ist nicht zu erwarten und zur Zeit auch gar nicht wünschenswert, dies hin zu einer allgemeinen Bewegung bestimmter normativer Setzungen formaler Prozeduren zu verallgemeinern. Eine lebensweltliche Orientierung in der Gegenwart bedeutet vielmehr, zwischen unterschiedlichen Konzepten und Optionen auswählen zu können. Im für die Wissenschaft glücklicheren Falle werden die dabei vorgenommenen Grundoptionen breit und differenziert reflektiert und legitimiert.
- Blicken wir über den Rationalismus hinaus in die gekränkte Vernunft durch Interaktion und Unbewusstheit, durch Imaginäres und Reales, dann erscheint die Suche nach einer letztlich formalen, universellen Vernunft als illusorisch. Längst ist die einheitliche Vernunft durch egoistische und abgegrenzte, partikulare, lokale und separatistische Interessen subvertiert. Vernunft bildet aus dieser Sicht ein brüchiges Band, ein Rekonstrukt von gemeinsamen Interessen und Beschränkungen von zu rigider, hegemonialer, unterdrückender Macht, ein Mittel, um den Dissens als Dissens halbwegs kulturell abgefedert zu leben, aber keineswegs mehr ein Konstrukt, dem wir euphorisch als Lösung aller unserer Probleme entgegen feiern können.
- Im Gegensatz zu Welsch halte ich deshalb Pluralität für einen Kampfbegriff, der von bestimmten Machtinteressen getragen wird. Als solcher dient er im Konstruktivismus nicht dazu, andere Ansätze davon zu überzeugen, ihre je eigensinnige, systemimmanente Perspektive, ihre Argumentationsordnung aufzugeben. Dies wäre nur ein erschlichenes Angebot, das tatsächlich nicht zu realisieren ist, weil alle Ansätze je ihre Ordnung und Doktrin, ihre Bevorzugungen und Auslassungen entwickeln. Das ist auch gut so, denn sonst wären sie nicht kritisierbar. Zwar haben wir konstruktivistisch gesehen einen universellen Maßstab solcher Kritik verloren, aber ein reflektierter und begründeter Maßstab im Rahmen einer Darlegung unserer partikularen, lokalen und ausschließenden Interessen ist uns geblieben. Wir sollten auch so offen sein, die darin liegende Begrenztheit, soweit es möglich ist, zu thematisieren. Damit gewinnen wir einen Maßstab, den wir in Verhandlungen, in Dialogen, in Auseinandersetzungen mit Anderen in jedem Einzelfall schärfen, erweitern, leben. Es ist ein Maßstab, der sich durch unsere Beziehungen und Lebenswelt angetrieben und ständig relativiert sieht, den wir nur zirkulär über die Auseinandersetzungen entwickeln können. Er ist veränderlich, brüchig, wandelbar. Und doch erscheint im Relativen auch stets das Absolute (vgl. die erste Kränkungsbewegung), weil wir immer einen eigenen Ansatz, eine bestimmte Perspektive, ein begründetes Denken usw. einsetzen, wenn wir uns über Maßstäbe verständigen. Nur dieses Absolute ist stets schon durch die Prozedur relativiert oder dekonstruiert (vgl. Band 1, Kapitel II.1).
Was erreichbar ist, das sind systemtranszendierende Angebote und Diskussionen, die helfen, das eigene Anliegen zu präzisieren und klarer abzugrenzen, um so eine interessen- und machtbezogene Auswahl durch Beobachter zu erleichtern. Auch der Konstruktivismus tritt bloß als ein Konkurrent auf dem Markt der theoretischen Möglichkeiten an. Er unterbreitet ein spezifisches Angebot für bestimmte Interessenten. Er bemüht sich dabei, Machtaspekte kritisch zu reflektieren. Aber er sieht zugleich die Notwendigkeit dieser ausschließenden und begrenzenden Legitimation ein. Dies macht ihn perspektivisch vielleicht offener dafür, sich möglichen anderen Sicht- und Denkweisen zuzuwenden. Aber es bedeutet keineswegs, dass er nunmehr aus solcher Zuwendung eine Generalisierbarkeit oder Universalität seiner Vernunft ableiten könnte.
3.3.3. Beziehungsfallen
Die Spiegelungen, die wechselseitige Anerkennung in zirkulärer Beziehungsdynamik, die imaginären Beanspruchungen des anderen und die realen Interaktionen mit Anderen, um hiermit an Analyseaspekte aus dem Kapitel Beziehungswirklichkeit zu erinnern, bieten hinreichend Anlass, Subjekte als einerseits freie Akteure und andererseits als eingeschlossen in Muster, in Fallen, in wiederkehrende Bezüge zu betrachten. In diesen Fallen sitzen die Beziehungspartner gefangen, sofern wir diese Gefangenschaft als ein Re/De/Konstrukt formulieren, das uns Abhängigkeiten, Komplementarität, Bindungen, Macht- und Geltungsfunktionen usw. zeigen soll. Aus der Sicht der Beziehungswirklichkeit habe ich als mögliche Fallen, in die man als Selbstbeobachter in Beziehungen geraten kann, die zirkulären Verstrickungen hervorgehoben. In diesem Abschnitt sollen die dargelegten Aspekte und Argumentationen nicht noch einmal wiederholt, sondern in drei Fragehorizonten lebensweltlich, also in einer größeren Perspektive, angegangen werden:
(1) Inwieweit kann und sollte lebensweltlich gesehen der Beziehungsaspekt eher als Struktur oder als Ereignis aufgefasst werden? Macht es überhaupt hinreichend Sinn, Muster von Beziehungen und damit strukturelle Beziehungsfallen zu re/de/konstruieren, wenn wir gleichzeitig die Ereignishaftigkeit und hohe Unschärfe und auch den Freiheitsgrad von Beziehungen anerkennen? Stecken Beziehungen mehr in einer Struktur- oder Ereignisfalle?
(2) Beobachter, die sich der Beziehungswirklichkeit widmen und diese lebensweltlich zu deuten versuchen, unterliegen einer hohen Komplexitätssteigerung in ihren Beobachtungen. Wie soll diesbezüglich mit dem Grundsatz verfahren werden, dass die einfachste Lösung zugleich die wissenschaftlich effektivste sein soll? Geraten Beziehungen dann in die Falle der Vereinfachung? Dies soll am Beispiel der Interpunktionen von Beziehungen gedeutet werden.
(3) Beziehungen wie auch die Lebenswelt vermitteln sich über Macht, d.h. Macht durchquert beide Beobachterebenen, wie wir mehrfach hervorgehoben haben. Benötigen wir dann aber nicht eine Begrenzung des Machtphänomens, um noch einen tragfähigen Ansatz zur Verwirklichung möglichst freier, offener, demokratisch orientierter Beziehungen zu erreichen? Oder erwägt der Konstruktivismus hier ein anything goes, das selbst die brutalsten Machtformen toleriert, wenn sie denn nur erfolgreich (d.h. innerhalb einer Verständigungsgemeinschaft viabel) durchgesetzt werden?
3.3.3.1 Beziehungen: Struktur oder Ereignis?
Übersetzen wir die Machtfallen nach Foucault auf Beziehungen, dann erkennen wir, dass Beziehungen sowohl nach der Perspektive einer Einheitssetzung (also als Struktur, Muster, Identität usw.) als auch eines Ereignisbezuges (also als Singularität, Individualität, Unbestimmtheit usw.) aufgefasst werden können. Wann immer wir aus der Perspektive einer wissenschaftlichen Zurechnung über Beziehungen verhandeln (also sie z.B. sozialwissenschaftlich, psychologisch oder pädagogisch erforschen), dann wird über kurz oder lang die strukturbezogene Seite meist dominant. Hieraus erwächst sehr leicht die Illusion, soziale Beziehungen in ihren Funktionsweisen umfassend zu verstehen. Dabei wird zunächst nur die Konstruktion eines Strukturmodells und dessen Anwendung in einem begrenzten Beobachtungsfeld verstanden. Zu einem Prüfpunkt solcher Beobachtungen wird es dann immer, inwieweit die Beobachtungen das Ereignis selbst thematisieren lassen. Aber inwiefern ist dies überhaupt möglich?
Der beziehungskritische Intellektuelle erkennt die Grenzen seines jeweiligen Strukturmodells. Er bemüht sich, die beobachteten Beziehungen selbst als Ereignisse zur Geltung kommen zu lassen. Dies allerdings ist schwierig. Befragt er die beobachteten Personen, so geht er meist schon von bestimmten Hypothesen aus, die das Ereignis strukturieren. Geht er in eine teilnehmende Beobachtung ohne eine vorgefertigte Strukturierung hinein, dann gerät das Rekonstrukt der Ereignisse trotzdem unter die Vorgängigkeit seiner Wahrnehmungen mit besonderen Vorlieben und Einstellungen. Insoweit könnte die Darstellung des Ereignisses, wie es sich unverfälscht ereignet, als mögliche Chance erscheinen. Aber dieses komplexe Chaos ist nicht unverfälscht darstellbar. Seine Darstellung lebt vielmehr durch eine imaginäre Motivierung und symbolische Herausstellung bestimmter Seiten, d.h. festgestellter Strukturen, die das Ereignis in einer Bedeutung für bestimmte Beobachter und deren Interessen erscheinen lassen. Jede Empirie trägt im Blick auf soziale Felder an dieser Überkomplexität der Ereignisse.
Der interaktionistische Konstruktivismus sieht das Spannungsverhältnis von Struktur und Ereignis für alle Beobachterperspektiven als wesentlich an. Für den Beobachter erscheint es als Spannungsverhältnis zwischen imaginären Vorstellungen oder symbolischen Bedeutungen auf der einen Seite und dem Erscheinen des Realen (der realen Ereignisse) auf der anderen. Dies gilt besonders für die Beziehungsfallen. Sie sind Ausdruck unserer heutigen Lebenswelt. Ganz gleich ob wir eine beobachtende Beziehungs-Perspektive auf Familien, berufliche Rollen oder Hintergründe von Verhaltensweisen in verschiedenen Lebensbereichen einnehmen, immer wirkt sich die Strukturierung dieser Perspektiven schon vereinfachend auf die Ergebnisse aus. So untersucht der Soziologe z.B. Veränderungen im Familienmuster (vgl. Beck/Beck-Gernsheim 1990), um sich dabei strukturell auf ein Modell von statistischen Beobachtungen und lebensweltlichen Deutungen zu beschränken, ohne die Beziehungswirklichkeit hinreichend kommunikativ (im Sinne von Kapitel III) zu diskutieren; umgekehrt fehlen familientherapeutischen Beschreibungen zu kommunikativen Störungen und Lösungen in Familien die lebensweltlichen Deutungen, die gesellschaftliche Problemlagen umfassend aufarbeiten. Sind wir damit nicht immer Opfer einer vorgängigen, vereinfachenden Strukturierung von Beobachtung, Beziehungswirklichkeit und Lebenswelt?
Die interaktionistisch-konstruktive Argumentation, die ich aufgebaut habe, versucht mindestens, die notwendige Strukturierung perspektivisch zu erweitern und zugleich auf die Ereignisse zurückzubeziehen. Dabei bieten sich drei wesentliche Möglichkeiten an:
- Rekonstruktiv bedeuten die geschilderten Kränkungsbewegungen, dass wir uns möglichen Strukturierungen nicht mehr vereinfachend als Dominanz nur eines Denkansatzes stellen, sondern wissenschaftlich eng legitimierte (teilweise empirisch abgesicherte) Beobachtungen, Beziehungen und Lebenswelt stets aufeinander beziehen, um eine Perspektivenvielfalt zu erreichen. Hierbei sind zwei Fehler besonders zu vermeiden:
- Interdisziplinarität sollte in wissenschaftlichen Strukturierungen nicht nur bedeuten, verschiedene wissenschaftliche Disziplinen aus einem Denkansatz heraus systematisch in ihren Perspektiven zu vereinigen, sondern muss auch beinhalten, widerstreitende Ansätze mit widerstreitenden Perspektiven hinreichend in das Spektrum einer eigenen Strukturierung aufzunehmen. Dies wird insbesondere durch Teamforschung über verschiedene Denkschulen hinweg erreicht.
- Transdisziplinarität erscheint als eine Möglichkeit, bisher nicht oder kaum in Verbindung getretene Beobachtungs- und Denkansätze stärker miteinander zu verbinden, um den Ereignischarakter gegenüber bisher üblichen, vorgängigen Strukturierungen wieder stärker zu betonen. Hier erweist sich gegenwärtig der Gegensatz von Geistes-, Gesellschafts- und Naturwissenschaften als besonders problematisch. Teamforschung über bestehende Fachgrenzen und übliche Kooperationen hinweg werden immer notwendiger.
- Dekonstruktiv ist ein steter Zweifel an der hinreichenden Vollständigkeit und methodologischen Sicherheit unserer Strukturierungen vorzunehmen. Der Dekonstruktivist als Beobachter und Forscher wird in unserer Kultur nicht hinreichend gefördert. Er bezweifelt die Strukturierungsversuche und gibt den Ereignissen ein größeres Recht zurück.
- Konstruktiv sind Lösungen gefragt, die eine beobachtende und wissenschaftliche Verantwortung für Strukturierungen nicht nur für Re- und Dekonstruktionen übernehmen – dies sind die klassischen Aufgaben der Wissenschaft –, sondern die verstärkt auch eine im Sinne der Strukturierung erfolgende Lösung von Problemen durchführen. Dies ist besonders für die Geistes- und Gesellschaftswissenschaften immer dann defizitär, wenn bestehende Zustände zwar re/dekonstruktiv kritisiert werden, aber keine eigene Lösung der Verbesserung erarbeitet wird. Symptomatisch ist dafür z.B. die Erziehungswissenschaft geworden, die überwiegend rekonstruktiv (als Wissenschaft) arbeitet und in der Breite es Praktikern überlässt, Reformmodelle einer besseren Pädagogik durchzuführen. Gegenüber der Reformpädagogik, in der noch eine Einheit von Theorie und Praxis festzustellen ist, hat sich die wissenschaftliche Theorie mehr und mehr von ihrer Praxis und einer eigenen, konstruktiven Mächtigkeit verabschiedet, um sich dann gleichzeitig über die Übermächtigkeit struktureller Vorgaben seitens des Staates und der Bildungspolitik zu beschweren. Dabei wird Wissenschaft immer auch an den eigenen konstruktiven Lösungen gemessen. Gewiss ist jede Rekonstruktion auch eine konstruktive Lösung von wissenschaftlichen Problemen. Aber erst wenn ein eigener Lösungsansatz als praktizierte Beobachtung, als gelebte Beziehungswirklichkeit und als tatsächliches Moment einer Teilnahme und Aktion in der Lebenswelt auftritt, erreichen wir Konstruktivität im umfassenderen Sinne. Für die Pädagogik habe ich dazu einen Ansatz entwickelt (vgl. Reich 2005, 2008, 2009).
Diese drei grundlegenden Perspektiven gelten in einem perspektivischen Zusammenwirken. Dabei fordert der interaktionistische Konstruktivismus dazu auf, nicht nur enge wissenschaftliche Beobachtungen im Sinne einer Objektivierung einzelner Gegenstandsbereiche zu leisten, die möglichst eindeutig begrenzbar sind. Wir sollten bei jeder Festlegung eines Eins nach den möglichen Auchs fragen. Dies gilt nicht nur systemimmanent für die wissenschaftlich erstrebten Objektivationen, sondern mindestens auch für eine Thematisierung, was dies für die Beziehungswirklichkeiten und die Lebenswelt bedeutet. Nur über eine möglichst weite Sicht haben wir überhaupt eine Chance, uns den Ereignissen umfassender zu stellen. Dass wir dies tun sollten, liegt daran, dass uns die Ereignisse doch immer wieder in ihren systemischen Rückwirkungen zu unseren Strukturierungen und Konstruktionen einholen.
Der Widerstreit zwischen Struktur und Ereignis ist unüberbrückbar. Er motiviert uns zu Lösungen der Vereinfachung. Daher ist es notwendig, die Vereinfachung stets kenntlich zu machen und möglichst kritisch zu reflektieren. Eine wesentliche Möglichkeit hierzu ist für die Seite der Beziehungsfallen die Untersuchung der Interpunktion, mit denen wir Ereignisse strukturell auflösen.
3.3.3.2 Interpunktionsfallen
Interpunktionen in zirkulären Prozessen sind jene Vorgänge, durch die ein Beobachter im Zirkel selbst oder als äußerer Beobachter oder Beobachter des Beobachters sich Muster, Regelhaftigkeiten beschreibt, um Ursachen, Wirkungen, Rückwirkungen festzuhalten und hieraus Bedeutsamkeit abzuleiten. Ein sehr einfaches Beispiel hierfür haben Watzlawick u.a. gegeben, indem sie die Interaktion eines Ehepaars beschreiben: Sie nörgelt, weil er immer in die Kneipe geht; er geht in die Kneipe, weil sie nörgelt. Beide interpunktieren in der Annahme, dass ihre Wahrnehmungskonstruktion die einzig richtige sei. Wie in sprachlichen Sätzen, so werden auch in zwischenmenschlichen Interpunktionen Satzzeichen gebildet, die einen Anfang, eine Mitte, ein Ende, ein Ausrufe- oder Fragezeichen setzen. So wird dem Anderen eine Wirklichkeit zugeschrieben, die zwar nur meine subjektive Wirklichkeit ist, aber in der Verallgemeinerung zu einer Beziehungsfalle gerinnt: „So bist du!“ Wer immer so bezogen angesprochen wird, der fühlt sich in der Falle und setzt seine Wirklichkeit entgegen. Ein Ausweg erscheint nur dann, wenn das wechselseitige Fallenstellen selbst problematisiert wird. Interpunktionen erscheinen mir allerdings komplizierter, als die Veranschaulichungen bei Watzlawick und anderen zeigen. Knüpfen wir dazu nochmals an Foucault an. Mit ihm haben wir weiter oben von den Ausschließungsgründen der Vernunft gesprochen, die sich im Zirkel mit der Unvernunft dadurch zu unterscheiden lernt, dass sie Abweichungen ausgrenzt und ggf. verfemt. Der Begriff der Interpunktion passt hier sehr gut. So wie es in einer Sprachgemeinschaft üblich ist, sich an die Regeln der Grammatik zu halten und hierdurch richtig zu interpunktieren – was eben auch falsche Interpunktionen nach eindeutigen Vernunftregeln ausschließt –, so gehört es zu den Merkmalen von Beziehungswirklichkeit, dass auch sie Prozeduren der Ausschließung unterliegt, die von vornherein zu gelten scheinen. „Die sichtbarste und vertrauteste ist das Verbot. Man weiß, dass man nicht das Recht hat, alles zu sagen, dass man nicht bei jeder Gelegenheit von allem sprechen kann, dass schließlich nicht jeder beliebige über alles beliebige reden kann. Tabu des Gegenstandes, Ritual der Umstände, bevorzugtes oder ausschließliches Recht des sprechenden Subjekts – dies sind die drei Typen von Verboten, die sich überschneiden, verstärken oder ausgleichen und so einen komplexen Raster bilden, der sich ständig ändert.“ (Foucault 1974, 7 f.)
Verbote sind damit Orte der Interpunktion, in sich selbst durchaus komplexe Muster. Es ist Teil der Interpunktionsspiele der Menschen, solche Verbote in bestimmten Bereichen zu lockern und sie in anderen besonders eng zu ziehen. So gehört es zu den Illusionen insbesondere der Wissenschaftswelt, mittels solcher Verbotsleistungen die Anderen, diejenigen, die nicht mitreden können, auszuschließen, wobei die dadurch entstehende Komplementarität die Gewähr für die eigene, richtige Denkhaltung zu bestärken scheint. Insoweit sind in Verboten – denken wir nur an Sexualität, Politik oder zugelassene Sprech- und Argumentationsgemeinschaften: Juristen, Ärzte, Lehrer usw. – immer Machtverhältnisse präsent. Menschliches Begehren findet in diesen Verboten den Zirkel von Ego und Alter, von Selbstverwirklichung und Fremden, von Selbst- und Fremdzwängen oder wie immer wir diese gesellschaftlichen Gegensätzlichkeiten, die wir im Umgang mit Wissen und Macht erleben, ausdrücken wollen.
Als zweite Interpunktionsmöglichkeit können wir neben dem Verbot mit Foucault die Grenzziehung bzw. Verwerfung heranziehen. Dies ist jene Ausschließung, die Foucault insbesondere mit dem Gegensatz von Vernunft und Wahnsinn beschrieben hat. „Seit dem Mittelalter ist der Wahnsinnige derjenige, dessen Diskurs nicht ebenso zirkulieren kann wie der der andern: sein Wort gilt für null und nichtig, es hat weder Wahrheit noch Bedeutung, kann vor Gericht nichts bezeugen, kein Rechtsgeschäft und keinen Vertrag beglaubigen, kann nicht einmal im Messopfer die Transsubstantiation sich vollziehen lassen und aus dem Brot einen Leib machen; andererseits kann es aber auch geschehen, dass man dem Wort des Wahnsinnigen im Gegensatz zu jedem andern eigenartige Kräfte zutraut: die Macht, eine verborgene Wahrheit zu sagen oder die Zukunft vorauszukünden oder in aller Naivität das zu sehen, was die Weisheit der andern nicht wahrzunehmen vermag.“ (Ebd., 8 f.)
Diese Ausschließung lässt sich, so denke ich, verallgemeinern und aus dem Exemplum von Vernunft und Wahnsinn herauslösen. Der Beobachter interpunktiert durch Grenzen und Verwerfungen, wenn er im Zirkel der Beziehung eine beliebige Grenze setzt oder einen Bruch sieht, aber auch wenn er eine Idee, eine Konstruktion verwirft. Grenzen erscheinen in Beziehungen stets dadurch, dass die Beziehung bestimmten Praktiken (insbesondere normativen), Routinen (insbesondere Mustern der Wiederholung und Gewohnheit) und Institutionen (insbesondere rechtlich abgesicherten Handlungsräumen) unterworfen ist (vgl. Kapitel IV.3.3.1.1). Verwerfungen stellen die Möglichkeit dar, bestehende Grenzen als brüchig zu erleben, also insbesondere einen Wechsel der Praktiken, Routinen oder Institutionen vorzunehmen. Dabei lassen sich Praktiken in der Regel leichter verändern als Routinen, Routinen leichter als Institutionen. Verwerfungen sind allerdings oft auch Abwehrhandlungen, um bestehende Grenzen gegen verändernde Außenwirkungen zu schützen.
Das Verbot ist, wenn wir näher hinsehen, ebenfalls eine Grenzziehung. Aber es liegt meistens vorgängig zu den Ich-Möglichkeiten, indem es einen Maßstab von Verwerfung als Sozialisationsleistung schon in das Ich gesetzt und in ihm begründet hat. Die Grenzziehung selbst schließt die Möglichkeit ein, die gesetzten Verbote rational zu transzendieren bzw. real zu überwinden. Sie kann Wiederholung von Verboten ebenso sein wie Auflösung solcher Verbote. In ihr kann die Betonung von durch Andere gesetzten Grenzen dominieren, sie kann aber auch zur Grenzziehung gegenüber solcher Dominanz entfaltet werden.
Grenzziehungen sind kulturell beeinflusst, aber nicht eindeutig determiniert. Sie fallen allerdings Menschen um so schwerer, wenn diese ihr Ich nicht stärken und den scheinbar leichteren Weg der Vermeidung gehen wollen.
Eine besondere Grenze bietet die Auffassung von wahr und falsch. Foucault nennt sie als einen dritten Ausschließungsgrund. Dieser ist zugleich der mächtigste, denn hinter ihm entfaltet sich ein Wille zur Wahrheit, der sich in gesellschaftlichen Institutionen versinnbildlicht und reproduziert. Es ist dies ein historisches, institutionelles, zwar veränderbares, aber doch je vorgängiges System von Lebens- und Verkehrsformen, nach dessen Geltung ausgeschlossen oder zugeordnet wird.
Es bleibt die Frage, warum ich gerade Ausschließungsgründe auf die Interpunktion beziehe. Es sollte deutlich sein, dass Interpunktionen in einem Beziehungszirkel Unterscheidungen eines Beobachters sind. Es sind damit jene konstruierten Punkte, an denen sich etwas in Zeit und Raum entscheidet und sichtbar (beobachtbar) wird. Es sind also Stellen, in denen der zirkuläre Fortgang selbst eine Unterbrechung, mithin eine Ausschließung erfährt. So entsteht in dem Beispiel des nörgelnden Ehepaares aus der Beobachtung des Paares selbst eine Ausschließung des eigenen Beteiligtseins am Zustand des zirkulären Musters, der eigenen Teilnahme und Aktion. Der äußere Beobachter beobachtet die Interpunktionen, die er als Ausschließungen erkennt und die er konstruierend zusammenfügt, um ein ganzes Bild zu erhalten.
Nehmen wir die drei Ausschließungsgründe verallgemeinernd auf, dann müssen wir sie allerdings auch von der Konstruktion einer einheitlichen Beobachtung befreien. Verbote reichen in den Beobachtungen bis hin zu den Überschreitungen des Verbotenen. Auch solches Überschreiten kann eine Interpunktion sein. Grenzziehungen und Verwerfungen reichen bis hin zur Selbstauflösung, zur Verwischung von Grenzen und zur Verschmelzung, mit der ebenfalls interpunktiert werden kann. Wahrheit findet ihren Kontrast im zugeschriebenen Falschen. So sind es jeweils mögliche Übergänge, Transformationen von Ausschließung, die in den Beobachtungen erscheinen, wenn wir diese selbst verflüssigen. Aber wir neigen auch dazu, diese Verflüssigung wieder imaginär zu verdichten und symbolisch zu vereinheitlichen, wenn wir bei Verboten von gehörig und ungehörig, angemessen und unangemessen, freundlich und unfreundlich, angenehm und unangenehm usw. sprechen. Im Rahmen der Grenzziehung lassen sich solche Gegensatzpaare konstruieren. Im Blick auf die von Foucault intendierte Gegensätzlichkeit von Vernunft und Wahnsinn sprechen wir z.B. gerne von rational und irrational, verstehbar und unverständlich usw. Und auch wahr und falsch zeigen Facetten der Konstruktion, die unendlich variieren können: Begründet und nicht begründet, hinreichend begründet und nicht hinreichend genug begründet, legitim und illegitim, eindeutig und uneindeutig, geordnet und kontingent usw.
Damit sehen wir in interaktionistisch-konstruktiver Interpretation, dass Interpunktionen selbst in Muster zerfallen, die ein Beobachter konstruiert. Es sind zunächst immer Konstrukte der sich direkt im Beziehungszirkel selbst Beobachtenden, dann Konstrukte der in Beziehung sich und andere Beobachtenden, wenn sie virtuell aus diesem Zirkel in eine andere Ebene des sich Beobachtens wechseln, schließlich Möglichkeiten dritter oder weiterer Beobachter, die außerhalb des Zirkels, und doch mehr oder weniger teilnehmend mit dem Zirkel verbunden, beobachten. Die Ausschließungsgründe sind Kontrollmechanismen, die bewirken, dass die Geltungsbedingungen des Beziehungszirkels überhaupt als Konstrukt entwickelt werden. Hier ist es wichtig festzuhalten, dass diese Ausschließungen nicht nur kognitiver Natur sind, sondern den ganzen Körper umfassen. Sie sind mit zentrifugalen oder zentripetalen (imaginären) Kräften in den Beziehungen verbunden (vgl. Kapitel III.2.3.2.2). Alle kommunizierten Inhalte in einer Beziehung als auch die Beziehungsebene selbst, die voll von affektiven Besetzungen und deren Kontrolle ist, sind betroffen. Die Inhalts- und Beziehungsebene sind damit zwei Beobachtungsbereiche eines Beobachters, der diese Sphären künstlich unterscheidet, um die Interpunktionen überhaupt in zugeschriebenen Perspektiven festlegen zu können. Auch diese Unterscheidung ist daher eine Grenzziehung, die durch Ausschließung besser sehen will.
Eine Beziehung ist damit eine Konstruktion, die sich setzt, indem sie andere(s) ausschließt. Über diese Ausschließungen entwickelt sie ihr je eigenes Gespräch.
Innerhalb der Entwicklung der Beziehung bemerken wir dabei eine Differenzierung von Ausschließungen und damit weitere Interpunktionen, die sich nach Prozeduren der Verständigung entwickeln: Sie erscheinen als Maßgaben von Klassifikation, Anordnung und Verteilung. Foucault beschreibt dies für die Problematik von Diskursen, die mit unterschiedlichen Ereignissen und Zufällen umgehen müssen. Um dies zu erreichen, kommentiert sich ein zirkuläres System.
Interpretieren wir auch dies aus konstruktivistischer Sicht. Kommentare beinhalten eine sehr unterschiedliche Reichweite. Am weitesten reichen solche, die den gesellschaftlichen Entwicklungsgang überhaupt mittels Erzählungen, Mythen, projektiven Selbst- und Fremdbildern wiederholen, tradieren, abwandeln usw. Dies reicht bis in die Kommentierungen einer Paarbeziehung oder in das Selbstgespräch. Der Kommentar wird zu einer Interpunktion von Ereignissen, die konstruierend zusammengefügt werden. Er entsteht besonders dort, wo Ereignisse Lücken aufweisen, wo es Sprünge oder Unpassendes gibt. Kommentare gleichen dies durch Konstruktivität aus. Der Kommentar ist die Versprachlichung oder Verbildlichung oder das Gefühl, die durch Beobachtung selbst entstehen und diese Beobachtung in die Bedingungen der Ausschließung einbeziehen und damit auf Handlungen und Teilnahmen zurückbeziehen. Auch Gefühle kommentieren, indem sie dem Beobachter Übereinstimmung oder Abwehr signalisieren (vgl. Kapitel III.2.2). Es ist hier das Spiel von Eins und Auch, das wir weiter oben kennenlernten, der Fluss der Imagination, die sich im Übergang ins Symbolische Wirklichkeiten schafft, indem sie etwas kommentiert. Einzel- und Gruppenkommentare unterscheiden sich, Sinn und Geltung sind unterscheidbar.
Foucault begrenzt den Kommentar, indem er darauf abhebt, dass er vor allem das zu sagen hat, was an anderer Stelle schon verschwiegen artikuliert war. „Das unendliche Gewimmel der Kommentare ist vom Traum einer maskierten Wiederholung durchdrungen: an seinem Horizont steht vielleicht nur das, was an seinem Ausgangspunkt stand – das bloße Rezitieren. Der Kommentar bannt den Zufall des Diskurses, indem er ihm gewisse Zugeständnisse macht: er erlaubt zwar, etwas anderes als den Text selbst zu sagen, aber unter der Voraussetzung, dass der Text selbst gesagt und in gewisser Weise vollendet werde. Die offene Vielfalt und das Wagnis des Zufalls werden durch das Prinzip des Kommentars von dem, was gesagt zu werden droht, auf die Zahl, die Form, die Maske, die Umstände der Wiederholung übertragen.“ (Foucault 1974, 18)
So betont Foucault für den Kommentar, dass das Neue nicht in dem Gesagten selbst, sondern in der Wiederholung liegt. Gerade dies ist für Beziehungen immer wieder typisch. Dabei jedoch müssen wir, so denke ich, zwei zusätzliche Positionen beachten, um solche Kommentierung zu situieren.
Einerseits kommentiert man nur, wenn man sich in seinem Kommentar selbst beobachtet und gegebenenfalls von Anderen hierin beobachtet wird. Kommentare sind nur im Blick auf einen solchen beobachtenden Kontext überhaupt möglich. Und in diesem Wechselspiel mögen sie alle möglichen Formen annehmen, die sich als Neues maskieren.
Andererseits aber sind wir es, ist es Foucault, der die Maske herunterreißt, indem er als äußerer Beobachter von Kommentaren sich über Kommentare äußert. Erst aus dieser Sicht ist es überhaupt möglich, die Wiederholung zu sehen und sich selbst als neuen Kommentar in das Spiel einzufügen. Da wir aber keine Begrenzung der Beobachter, die neben- oder nacheinander stehen, angeben können, ist die Möglichkeit der Kommentierung über die wiederkehrenden Kommentierungen jeweils neu und anders möglich. Deshalb gibt es keine letzten Meta-Kommentare.
Kommentare sind sekundäre Bearbeitungen eines Beobachters, der sich in sich situiert weiß oder aber auch virtuell aus sich heraustreten kann, um gleichsam mit einer anderen Perspektive auf die Ereignisse zu schauen. Von dieser Perspektive aus entdeckt er die Wiederholungen, die Muster, die er konstruierend und kommentierend entwirft. Mit ihnen tritt er bearbeitend in die Beziehungszirkel ein, in denen er auch imaginär verdichtend und verschiebend operiert. Dort, wo ihm diese Perspektiven seiner Konstruktionen nicht in den Sinn kommen, befindet er sich meist in der Wiederholung eines je schon erreichten Musters, dessen Kommentierungen bloße Wiederholungen als Anpassung sind.
Insofern werden die Interpunktionen von einem Beobachter besorgt, der selbst wie eine Instanz (der Sorge) in der Zirkularität von Beziehungen auftritt und die Diskurse in diesen führt. Durch seine Kommentierungen erweitert er die Texte, schafft er Neues, um sich zugleich zu wiederholen. So wird der Beobachter selbst zur Stelle der Verknappung des Neuen, indem er Muster konstruiert.
Hier mag die Frage entstehen, welche Beobachter wir dann noch namhaft für die Entstehung wirklich neuer Beobachtungen und damit für Wechsel in Interpunktionen machen können. Für Foucault ist das die Frage nach dem Autor. Hinter ihm steckt ursprünglich die Autorität der Aussage, die auf seine Authentizität als besonderer Mensch zurückweist. „Der Autor ist dasjenige, was der beunruhigenden Sprache der Fiktion ihre Einheiten, ihren Zusammenhang, ihre Einfügung in das Wirkliche gibt.“ (Ebd., 20) Diese Aussage trägt stark rekonstruktiven Charakter. Der Autor mag konstruktivistisch gesehen aber auch der beruhigten Sprache ihre Beunruhigung über das Imaginäre zurückgeben, wenn er seine Interpunktionen setzt. Gleiches wird lebensweltlich meist von den Beobachtern verlangt, die die Wirklichkeit originär schauen: Auch sie müssen in ihrer Authentizität abgesichert erscheinen. Diese Ansicht hat wissenschaftliche Beobachtungen immer stärker in das Korsett enger Beobachtungswirklichkeiten gezwungen, die sich durch die Wiederholbarkeit der gewonnenen Beobachtungen ihre Wirklichkeit schaffen. So wird der Beobachter entindividualisiert und verallgemeinert, um ihn zu kontrollieren. Das Misstrauen richtet sich in solcher Weltsicht auf das Individuum, aber kaum mehr auf diese Zuschreibung von Interpunktionen selbst.
Der Wechsel von Fremdbeobachtungsleistungen hin zu immer stärkerer Selbstbeobachtung, den ich für den zivilisatorischen Prozess mit Elias bezeichnet habe (vgl. Band 1, Kapitel I), erzwingt vor diesem Hintergrund für die Beobachter eine doppelte Interpunktionsfalle: Einerseits kommentieren die Beobachter ihre eigene Identität in der Form der Masken der Wiederholung, und sie binden sich hierüber den Texten, Bildern, Gefühlen ihrer Epoche ein; andererseits bleiben sie Beobachter oder Autoren einer Sicht, die sich darin auch neu schauen können und einen Meta-Kommentar ihrer Beobachtungen finden, der sie zumindest in dem Muster der Wiederholung und dann auch gegebenenfalls der möglichen Veränderung zeigen lässt.
Bleiben wir in der ersten Position des Beobachtens, so unterliegen wir der Wiederholung, ohne sie zu bemerken. Es geht uns wie dem Ehepaar, das sich streitet, weil er ständig in die Kneipe geht, weil sie nörgelt; sie aber nörgelt, weil er ständig in die Kneipe geht. Nach diesem Muster organisieren sich viele Beziehungswelten.
Die zweite Position vermag solche Muster zwar zu schauen und dadurch in ihrer Interpunktion zu bezweifeln, sie vermag uns die Zirkularität, die Ganzheit solcher Interpunktionen als einen Blick auf sie zu zeigen, aber sie ist doch nie die Gewissheit eines vollständigen Schauens von wahren Mustern, die immer gelten. Denn dann müssten wir die letzte Beobachterposition im Neben- und Nacheinander gefunden haben, um sicher alle möglichen Interpunktionen zu überschauen. Behaupten wir dies, so sitzen wir erneut in der Falle der ersten Position.
Wie sollen wir uns damit jedoch überhaupt noch der Behauptung von Interpunktionen als Charakterisierung eines allgemeinen Musters sicher sein? Zerfällt mit dieser Sicht nicht alles in Beliebigkeit?
Es zerfiele in der Tat in Beliebigkeit, wenn wir den Beobachter als zeitlose Gestalt konstruierten und kommentierten, wenn er rein subjektiv, ahistorisch, getrennt von seinen sozialen und kulturellen Kontexten bliebe. Dieser Beobachter wäre eine Fiktion außerhalb der Lebenswelt. Der Beobachter verliert für den interaktionistischen Konstruktivismus aber seine Fähigkeit, subjektive Einzelheit überhaupt hinreichend praktizieren zu können, weil er systemisch stets schon in Lebenswelt eingeschlossen ist. Akzeptieren wir dies, dann bleibt dennoch Verständigung möglich, weil wir einen solchen Beobachter im Neben- und Nacheinander von Anderen, von sozialen Interessen, von Bedürfnissen usw. situieren können, weil wir über die imaginative Kraft und eine symbolische Umwandlung dieser Kraft in Verstehen als Aushandeln mit Anderen (auch im Sinne von Dissens) verfügen. Wir verlieren die Strenge eines Ausschließungstatbestandes und gewinnen die Offenheit für unterschiedliche Sichtweisen, die sich ausschließen. Insofern sich daher bestimmte Interpunktionen in unsere Beobachtung als Muster einschleichen und wir mit ihnen erfolgreich arbeiten, d.h. konstruktive Zuschreibungen vornehmen, bleiben wir durch die Individualität des Beobachters, durch sein Ich selbst davor gewarnt, Unterschiede auszuräumen, um unsere Suche nach Mustern vorschnell zu befriedigen. In unserem Alltag erfahren wir oft, dass es uns so durchaus gelingen kann, die widersprüchlichsten Sichtweisen in uns und von uns nach- und nebeneinander zu erlauben, ohne darüber im Sinne strenger ausschließender Vernunft der Wissenschaft verrückt werden zu müssen. Insbesondere der Pragmatismus reflektierte auf diesen Umstand und entwickelte dazu wesentliche Einsichten, indem er die gerechtfertigten Behauptungen auch der Wissenschaft an die lebenspraktischer Bedingungen des Handelns zurückknüpfte und auch Wissenschaft als Handlung begründete.
Thomas Kuhn (1976) hat darauf aufmerksam gemacht, dass insbesondere die Wissenschaften Muster ausprägen, die für die jeweiligen Konstrukteure wie zeitlose Botschaften durch die Diskurse kreisen, für die Entwicklung jedoch nur als Punkte in einem Prozess gelten können. Hier sehen wir die Kreisförmigkeit der ewig gleichen Fragen, aber auch die variierenden Antworten, die sich mehr oder minder auf vergangene Beobachtungen beziehen und diese kommentieren. Der Blick auf das wiederholende Muster ist der Kommentar, der der Wiederholung dient (Rekonstruktion) oder diese dekonstruktiv entlarvt. Der Blick auf die Entwicklung zeigt die Individualität von Beobachtungen, indem wir Punkte in der Spirale der Entwicklung ausmachen, an denen Neues entstand. Dies führt bei rekonstruktiver Dominanz oft in eine naive Fortschrittsgläubigkeit. Daher ist auch hier eine dekonstruktive Perspektive wichtig, um nicht in einfachen Diskursen der Anpassung zu enden.
In der Wissenschaft spricht man gerne von Disziplinen, um die Beschränkung, die Disziplinierung zu betonen, die darin wurzelt, sich hin auf einen Beobachtungsvorrat und einen Modus bevorzugter Beobachtung auszurichten. Damit wird interpunktiert. Damit wird zugleich oft die Möglichkeit des Neuen verhindert. Blicken wir genauer hin, dann erkennen wir mit Foucault eine wichtige Rahmenbedingung wissenschaftlicher Interpunktionen: „Innerhalb ihrer Grenzen kennt jede Disziplin wahre und falsche Sätze, aber jenseits ihrer Grenzen lässt sie eine ganze Teratologie des Wissens wuchern.“ (Ebd., 23) Dort schleichen die Monstren unmittelbarer Erfahrung herum, die Imaginationen, die Grenzen überschreiten, dort atmet das Heterogene, dort lauert der Alien, dort gibt es nicht einmal einen Irrtum „im strengen Sinn, denn der Irrtum kann nur innerhalb einer definierten Praxis auftauchen und entschieden werden“ (ebd.). In diesem Innerhalb der Beobachtungsposition und der mit ihr eingenommenen Kommentierung erscheint eine „diskursive Polizei“, die die Disziplin als Kontrollprinzip umsetzt und zu einer permanenten Reaktualisierung der Regeln des Beobachtens führt (ebd., 25).
Die Etablierung wissenschaftlicher Diskurse, um die Interpunktionen wahrhaft beurteilen zu können, geht zugleich mit einer Verknappung der beobachtenden Subjekte einher, denen solche gültige Beobachtung überhaupt als Teilnahme aktiv zugestanden wird. Sie entmündigen die subjektiven Massen, indem sie in ihrem gutachterlichen Zirkel jenes Geheimwissen etablieren, das als Medizin, Mathematik, Rechtswissenschaft oder welche Wissenschaft auch immer erscheint. Diese Disziplinen zu sichern, werden Rituale aufgerichtet, die die Qualifikationen schützen, die Gesten, Verhaltensweisen und besonderen Umstände definieren und die Zeichen begrenzen, die Geltung beanspruchen (vgl. ebd., 27). So diszipliniert sich das Wissen als Geheimnis, das nur durch lange und mit Zulassungsbeschränkungen versehene Aneignungswege zu einem Besitz werden kann, der sinnvolle und wissenschaftlich hinreichende Beobachtungsinterpunktionen erlaubt. Die Kommentierungen dieses Rituals sind längst umfassender geworden als die tatsächlichen Regeln, nach denen beobachtet wird. Das Geheimnis produziert ständig neue Variationen, um Geheimnis bleiben zu können. So wird die vermeintlich freie Beobachterposition der Moderne und der Demokratien durch Ausschließungsgründe reguliert, die wahre von falschen Beobachtungen sondieren. Vor Gericht, in der Politik, in der Wissenschaft, in den Bürokratien, insgesamt bei gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen gelten solche ritualisierten Beobachterstandpunkte mehr als jede andere Position. Gleichwohl führen sich die wissenschaftlichen Disziplinen in ihrem Wahn nach einzig gültiger Interpunktion von Beobachtungen immer mehr dadurch ad absurdum, dass sie selbst in Widersprüchlichkeiten zerfallen sind, die unter ihrem Namen als vermeintliche Einheit verborgen und verschleiert werden. Pluralität und Dissens holen alle Entscheidungen ein. So streiten am Ende die Gutachten gegeneinander, und die Öffentlichkeit glaubt naiverweise noch an das persönliche Versagen einzelner Gutachter, statt sich des Rituals selbst kritisch anzunehmen.
Die Beziehungswirklichkeit unterliegt im Blick auf solche Diskurse oft einem Begründungs- und Erwartungsdruck. Eine äußere Position des Wissens soll als Entscheidungshilfe für Entwicklungen, Ausschließungen, Veränderungen in Beziehungen herangezogen werden, um den verunsicherten Beobachter normativ zu leiten. Hier wuchert eine unendliche Ratgeberliteratur, deren Vorschläge als normative Kommentare die Beobachter disziplinieren. Der Beobachter muss Kraft aufwenden, sich gegen die Interessen jener, die immer schon für ihn beobachtet haben, zu wehren. Dazu muss er zunächst zurück zu seinen Imaginationen finden. Was motiviert die eigenen Symbolsetzungen? Und auch, wenn es hierauf keine klaren Antworten gibt: Was sind die Interpunktionen, die sich un/bewusst ergeben haben?
Bei den Interpunktionen kommt es darauf an, sich als Beobachter ständig selbst zu verdächtigen. Denken wir an Universalien unserer Beobachtung, so sollten wir den Blick gezielter auf das Besondere lenken, das uns jene Illusion wieder nimmt. Denken wir an höhere Wesen, höhere Leistungen oder ein allgemein Höheres, so sollten wir besser zunächst auf das Sinnlich-Körperliche blicken, bevor uns die Sinne und die Körper in Illusionen abstrakter Welten aufgehen. Denken wir an Ordnung und nichts als Muster solcher Ordnung, dann sollten wir das Kontingente aufsuchen, um uns unsere Illusion von Ordnung zu relativieren. So leisten die damit vollzogenen Umdeutungen zumindest, dass wir immer dann, wenn wir in der Zirkularität unseres Denkens auf die Schematisierungen einer verdinglichten Beobachterwelt zurückfallen, diesen Rückfall nicht mit einem Gewinn von wahrer Erkenntnis und einem Sieg über die Unschärfe unserer Beziehungswirklichkeit verwechseln.
3.3.3.3 Die Machtbindung von Beziehungen und Lebenswelt – Adornos Variablen
zum autoritären Charakter neu gedacht
Die Diskussion der Objekt- und Machtfallen zeigte lebensweltliche Praktiken, Routinen und Institutionen, die für Beziehungen immer eine Relevanz und einen Kontext darstellen. Eine besondere Art von Beziehungsfalle sind Einstellungen und Haltungen, die sich unter dem Stichwort des „autoritären Charakters“ zusammenfassen lassen. Hier bin ich insbesondere durch die persönliche Begegnung mit Ernst Federn, der sieben Jahre im Konzentrationslager überlebte, dafür sensibilisiert worden, wie konkret Machtmechanismen hierbei zu erfassen und zu diskutieren sind (vgl. dazu mein Beispiel in Reich 1993, 1996 a und online hier, das ich im Blick auf die Erfahrungen von Bettelheim und Federn im Konzentrationslager dargestellt habe; dort geht es um die Frage einer systemischen Wechselwirkung zwischen Tätern und Opfern und Konsequenzen, die daraus für ein dekonstruktivistisches Erziehungsziel zu ziehen sind). An dieser Stelle will ich auf Theodor W. Adorno eingehen, der in seinen „Studien zum autoritären Charakter“ (1973) der Frage nachgegangen ist, warum bestimmte Menschen antisemitische und undemokratische Haltungen einnehmen und andere nicht. Adorno versuchte unter dem Eindruck des Nationalsozialismus bestimmte Typologien von politischen Haltungen zu entwickeln, die unter dem nicht unproblematischen Begriff „Charakter“ gefasst wurden. Günstiger wäre es, hier von einem Habitus zu sprechen, der verschiedene Haltungen und deren Erzeugungsmechanismen beschreibt, da der Begriff Charakter oft naturgemäß im Sinne anlagebedingter Dispositionen festgeschrieben scheint. Adorno jedoch spricht von Dispositionen, die durch Sozialisation angeeignet wurden und die selbst veränderlich sind. Interessant an seiner Arbeit ist, dass er unter dem Einfluss der Psychoanalyse hierbei eher psychologische – oder beziehungsmäßige – Aspekte als Variablen definierte, die einen bis heute wichtigen Erklärungsansatz bieten können. Es geht dabei nicht nur darum, bestimmte gesellschaftlich wirksame Verhaltensweisen zu bezeichnen, sondern zugleich bis auf die Beziehungsebene konkret zu bestimmen, wie sich die Lebenswelt mit der Beziehungswelt in bestimmter Weise vermittelt. Ich will auf das Werk, das in umfassender Autorenschaft auch mit anderen Forschern stand, hier nur sehr beschränkt eingehen, indem ich mich allein auf die Variablen konzentriere, die antidemokratisches Verhalten beschreiben lassen. Diese Variablen werde ich dann mit von mir gesetzten beziehungsbezogenen Aspekten vergleichen, um damit einen konstruktivistischen Weg auszudrücken, wie wir heute auf der Beziehungsebene Verhaltensmerkmale bestimmen und auch empirisch untersuchen können, die eine demokratische Orientierung zum Ausdruck bringen. Adornos Variablen drücken negativ gesehene Eigenschaften aus, für die aktualisierte Fassung aus konstruktivistischer Sicht wähle ich positiv erwünschte Verhaltensweisen:
|
Adornos Variablen antidemokratischen Verhaltens
(1973, 45 ff.) |
Interaktionistisch-konstruktivistische Merkmale demokratischen Verhaltens |
1 |
Konventionalismus |
Pluralismus und Diversität |
2 |
autoritäre Unterwürfigkeit |
symmetrische und komplementäre Beziehungen |
3 |
autoritäre Aggression |
gewaltloser Widerstand |
4 |
Anti-Intrazeption (Gefühlsabwehr) |
Empathie und Sensibilität |
5 |
Aberglaube und Stereotypie |
Paradoxie, Ironie und Ambivalenz |
6 |
Machtdenken und „Kraftmeierei“ |
Begrenzung hegemonialer Macht |
7 |
Destruktivität und Zynismus |
Ressourcen- und Lösungsorientierung |
8 |
Projektivität |
Perspektivität |
9 |
übertriebene Beschäftigung mit Sexualität |
Sex und Gender |
zu 1) Konventionalismus versus Pluralismus/Diversität
Konventionalismus bedeutet für Adorno eine starre Bindung an die konventionellen Werte des Mittelstandes, wobei die Anpassung an vorherrschende Werte offenbar viele Vorurteile generiert. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen Konventionalismus und antidemokratischem Potenzial dann nicht zwingend, wenn zugleich ein soziales Gewissen entwickelt wird (ebd., 47). Konventionalismus im engeren Sinne ist deshalb nur dann gegeben, wenn ein Individuum durch gesellschaftlichen Druck starr an gesellschaftlichen Normen festhält, die es durch eine augenblickliche Identifizierung mit einer Kollektivmacht (ohne eigenes, kritisches Gewissen, ohne innere Ich-Stärke) gewinnt.
Der konventionelle Spießbürger, den Adorno noch vor Augen hatte, erscheint heute in pluralisierter und diverser Form. Dabei ist diese Pluralität und Diversität zugleich sein Verhängnis wie seine Überlebenschance. Zunächst erzwingt die Pluralisierung der Gesellschaften durch Erhöhung der Migrationsströme und Globalisierung der Warenmärkte bei allen lokalen Rückschritten, die es auch gibt, die Auflösung allmächtiger Kollektivmächte, so dass zwar nicht der Konventionalismus verschwindet, aber wohl seine bindenden Kräfte an große Hegemonien, die unbezweifelt sind. Je mehr dies geschehen kann und politisch durchgesetzt bleibt, desto stärker mag sich eine Diversität äußern, die genuin ein Feind des starren Konventionalismus ist. Eine solche Diversität bringt zugleich ein Bewusstsein für die Mächtigkeit der Konstruktivität hervor, die sich darin ausdrückt, dass die Menschen (und nicht nur die Konstruktivisten) begreifen, dass ihre Konventionen Konstrukte auf Zeit sind, die sich nicht mehr starr und unwiderrufbar zuschreiben lassen. Aber da wir wissen, dass es sich um Konstrukte handelt, wissen wir auch davon, wie schnell sich Platz und Zuschreibung ändern können. Insoweit sind Pluralität und Diversität Kampfbegriffe einer Demokratie, die von den Akteuren und Teilnehmern immer wieder eingefordert und gegen einen möglichen Konventionalismus der Vereinheitlichung kritisch verteidigt werden müssen.
John Dewey (MW 9, 89 ff.) hat zwei Kriterien für demokratisches Verhalten entwickelt, an die sich der Konstruktivismus anschließen kann (vgl. auch Reich 2005; 2008):
(1) Wie vielfältig und unterschiedlich sind die bewusst geteilten gemeinsamen Interessen in einer Community? Demokratie kann sich dort leichter entwickeln, wo es zahlreiche und unterschiedliche Interessen gibt, weil und insofern es hier Wege des Denkens gibt, in denen die Unterschiede der Interessen innerhalb eines sozialen Rahmens geachtet und entwickelt werden. Dann kann sich auch kein starrer Konventionalismus ausprägen, sondern es wird Diversität innerhalb der Gemeinschaft geschätzt und geachtet.
(2) Wie vollständig und frei ist der Austausch mit anderen Communities? Demokratie kann sich dann leichter entwickeln, wenn die Interaktion mit Unterschieden nicht nur in einer sozialen Gruppe, sondern vor allem zwischen unterschiedlichen sozialen Gruppen in einer Gesellschaft tatsächlich stattfindet. Wenn und insofern Verhaltensweisen in der Gesellschaft entwickelt werden, die kontinuierlich und konstant neue Herausforderungen hervorbringen und diese an den sozialen Wechsel mit unterschiedlichen Interaktionen anzupassen verstehen, wenn dies so geschieht, dass sich die unterschiedlichen Gruppen in ihrer Unterschiedlichkeit respektieren und in den Interaktionen miteinander auskommen, dann wird ein starrer Konventionalismus keine Chance als Zuflucht in eine hegemoniale Kollektivität haben.
zu 2) autoritäre Unterwürfigkeit versus symmetrische und komplementäre Beziehungen
Autoritäre Unterwürfigkeit bezeichnet bei Adorno eine unkritische Unterwerfung unter idealisierte Autoritäten, die der eigenen Gruppe angehören. Zwar sind solche Unterwerfungen im Sinne von Gehorsam, Respekt usw. gegenüber anderen Personen durchaus verbreitet und z.B. in der Erziehung üblich, aber hier ist ein übermäßiger, totaler, emotionaler Mechanismus gemeint, der ein Bedürfnis nach Unterwerfung in masochistischer Weise ausdrückt. Entweder fehlt auch hier ein eigenes Gewissen und eine entsprechende Moral oder die Unterwürfigkeit soll helfen, ambivalente Gefühle gegenüber Machtpersonen zu begrenzen, indem sie in Ehrfurcht, Gehorsam oder Dankbarkeit gegenüber Autoritäten unkritisch transformiert wird (Ich-Schwäche).
Solche Unterwürfigkeit mag nicht nur Personen gegenüber geübt werden, sondern auch gegenüber Religionen oder Ideologien. Hier begibt man sich in eine komplementäre Rolle, wobei die eigene Unterwerfung zugleich einen Machtzuwachs durch Teilhabe an einem System/einer Ideologie bedeutet.
In der konstruktivistischen Kommunikationstheorie wäre autoritäre Unterwürfigkeit eine durchgehend komplementäre Beziehung, die zu wenig Ich-Autonomie erlaubt und die grundsätzlich als beziehungszerstörend angesehen wird. Aber die Alternative ist nicht eine durchgehend symmetrische Beziehung, in der alles gleich zwischen den Individuen gemacht oder geteilt werden muss. Auch eine solche Beziehung wäre zutiefst zerstörend und würde in Konsequenz immer wieder in symmetrische Eskalationen führen, um sich gegenseitig zu beweisen, wie viel gleicher der eine als die andere ist. Der beziehungsmäßige Idealfall ist eine diskontinuierliche, d.h. nicht durchgehend festgelegte und in stetigem Wechsel stattfindende Beziehung mit Symmetrien und Komplementarität. Dies setzt voraus, dass beide Seiten jedoch immer in Frage gestellt und ausgetauscht werden können, sofern die Möglichkeit und Bereitschaft hierzu entwickelt werden kann. Die Möglichkeiten (z.B. durch Beruf, familiäre Verpflichtungen, eigene Ressourcen usw.) mögen nicht immer umfassend in Autonomie gegeben sein, aber die Bereitschaft, die eigene Position und Haltung zu diskutieren, ist eine entscheidende Voraussetzung, um unterschiedlichen Formen von Unterwerfung zu entkommen und Ich-Stärke als Bereitschaft zu eigenen Handlungen und Verantwortungen zu entwickeln. Dies ist der bleibende Kern der Botschaft Adornos: Ein soziales Gewissen auch im Blick auf andere Menschen wird sich nur dort breit entfalten können, wenn an der Ich-Stärke gearbeitet wird und die Erhöhung des Ichs durch Teilhabe an äußeren Mächten als das durchschaut werden, was sie ist: eine Unterwerfung. Insbesondere sind komplementäre Beziehungen dort verdächtig und kritisch, wenn einer der Beziehungspartner dadurch an Autonomie, kritischer Haltung, Partizipation an Entscheidungen, Dialogmöglichkeiten oder Ausstiegschancen (Freiheitsrechten) gehindert würde. In den gelebten menschlichen Beziehungen, so eine zentrale These des interaktionistischen Konstruktivismus, entscheidet sich auch eine demokratische Grundhaltung, denn wenn ich nicht gewillt bin, mich in meinen unmittelbaren Beziehungen zu unterwerfen, dann werde ich potenziell auch an autoritärer Unterwürfigkeit im gesellschaftlichen Rahmen keinen Spaß finden. Je stärker in familiären Systemen eine reflektierte Balance mit symmetrischen und komplementären Verhaltensweisen produktiv als Entwicklung von Ich-Stärke erfahren werden kann, desto höher mag die Wahrscheinlichkeit sein, dass die Sehnsucht nach unumschränkter Komplementarität gar nicht erst aufkommt.
zu 3) autoritäre Aggression versus gewaltloser Widerstand
Die autoritäre Aggression versteht Adorno als eine Tendenz, „nach Menschen Ausschau zu halten, die konventionelle Werte missachten, um sie zu verurteilen, ablehnen und bestrafen zu können.“ (Adorno 1973, 45) Eine strikte Hierarchie und Unterwürfigkeit produziert Hackordnungen nach unten. Hier erscheint die sadistische Seite des Autoritarismus. Jemand, der sich selbst unkritisch unterworfen hat, muss diejenigen, die sich nicht ebenfalls unterwerfen, besonders streng verfolgen und bestrafen. Das eigene Verhalten wird als „anständig“, „tüchtig“, „angemessen“ beschrieben, Andersartige und Fremde werden bestraft. Insbesondere benötigt dieser Mechanismus zahlreiche Sündenböcke, um die eigene „Qualität“ zu demonstrieren. Für Adorno ist dies kein äußerer Vorgang, sondern er entspringt dem Umstand, dass die eigene psychische Unfähigkeit, sich Autoritäten nicht unkritisch zu unterwerfen, verdrängt wurde und sich nun eine Bahn sucht, diese Verdrängung aktiv durch Bestrafung anderer zu leben.
Autoritäre Aggression ist eine Form aggressiven Verhaltens, die auch typisch für Gewalt ist, wie sie in post/modernen Gesellschaften erscheint. Zwar ist diese Aggression hier nicht immer mit politischen Führern, sondern auch mit anderen Abhängigkeiten von Machtpersonen auf sehr begrenzter Ebene verbunden, doch die Wirkungen sind recht ähnlich. Je demokratischer orientiert eine Gesellschaft ist, desto größere Schwierigkeiten hat sie, mit diesen Formen von Aggression umzugehen. Wenn die post/modern freien Konstruktionen durch Eruptionen von Gewalt das Welt- und Lebensbild – auch der Konstruktivisten – erschüttern, dann schlägt eine Beziehungsfalle zu: Jeder in der Familie soll sich im Sinne einer heute von vielen für gültig gehaltenen Ordnung frei entwickeln, äußern, multiplizieren und differenzieren, individuieren dürfen, aber was geschieht, wenn er dabei einen Anderen durch sein Verhalten genau hierzu nicht mehr kommen lässt? Es ist eine klassische Frage, die Kant mit dem kategorischen Imperativ beantwortet wissen wollte. Aber was geschieht, wenn sich der Mensch nicht aufgeklärt, sondern verstört verhält? Je höher die Individuation ist, desto stärker können sich auch Gewaltszenarien individuieren.
Für die Arbeit mit Gewalt in Familien haben Haim Omer und Arist von Schlippe (2002, 2004) ein Konzept des gewaltlosen Widerstands entwickelt, das als eine Antwort auf jene geschrieben ist, die Aggressionen äußern und dabei selbst ihr engeres Beziehungssystem verstören. Unter der Einsicht, dass ein Verhalten gegen die Gewalt, das selbst Gewaltmittel benutzt, nur ein schlechtes Vorbild hervorbringen kann, gleichzeitig aber Nichttun oder Ignorieren die Aggressionen meist sogar verstärkt, ist dieses Konzept darauf gerichtet, Präsenz zu zeigen und Grenzen gewaltfrei zu ziehen. Mahatma Gandhi hat als Vorbild bei dem Ansatz Pate gestanden. Für Haim Omer gibt es zwei Arten von Eskalation zwischen Eltern und Kindern mit Aggressions- und Disziplinschwierigkeiten:
a) eine komplementäre Eskalation, wobei die elterliche Nachgiebigkeit zu je steigernden und meist unerfüllten oder unerfüllbaren Forderungen führt,
b) eine symmetrische Eskalation, wobei die Feindseligkeit des einen eine Feindseligkeit des anderen hervorruft.
Hier nimmt Omer das auf, was wir bereits über symmetrische und komplementäre Beziehungen aus Sicht der Kommunikationstheorie diskutiert haben. Entscheidend für das Konzept des gewaltlosen Widerstands ist es, aus den Eskalationen herauszutreten, ohne an Präsenz zu verlieren. Präsenz ist wichtig, um zu zeigen, dass man mit der Gewalt nicht einverstanden ist, dass man Alternativen sucht, dass man eine gemeinsame Lösung anstrebt, wobei der positive Lösungsvorschlag vom Aggressor kommen sollte, dass man in jedem Fall das vermeidet, was nur neue Aggressionen hervorruft. Hier ist es insbesondere wichtig, aus einer emotionalen Eskalation auszusteigen, also eine Lösung nicht im Konfliktfall selbst zu suchen, sondern dies auf später zu verschieben. Weder Predigten, Bitten noch Anschreien oder Drohungen helfen in Konfliktfällen, sondern nur eine Lösung, in der der betroffene Aggressor selbst eine Lösung für ein anderes Verhalten vorschlägt. Solche neuen Grenzen durch Dialog mittels der klaren Botschaft zu führen: „Ich kann dein Verhalten nicht akzeptieren und werde es auf jeden Fall zu stoppen versuchen, aber dich weder schlagen noch irgendwie attackieren“ – das ist der Weg des gewaltfreien Widerstands. Er dient dazu, eine Ich-Stärke und kritische Distanz zum eigenen Verhalten aufzubauen, die der Gewalttätige noch nicht hinreichend erlernt oder verlernt hat. Es ist kein Weg der Schwäche, sondern ein sehr präsenter, den viele Eltern durch Mangel an Präsenz vergessen haben. Lange haben sie weggesehen, jetzt merken sie auf einmal, dass es so nicht weitergehen kann. Und es ist nicht nur ein Weg für die Eltern, sondern auch für die Schule und andere Erziehungsorte. Eine Gleichgültigkeitspädagogik fördert Aggressionen statt sie zu bremsen, wenn sie sich der Erziehung und Grenzsetzung verweigert. Oft unwissentlich fördert sie damit auch antidemokratisches Verhalten, denn Gewalt kann nie ein Lösungsweg in der Demokratie sein. Aggressionen haben sich gegenüber den Szenarien, von denen Adorno ausgegangen war, differenziert. Wir benötigen ebenso differenzierte, aber auch klare Konzepte um ihrer Zunahme zu begegnen.
zu 4) Anti-Intrazeption (Gefühlsabwehr) versus Empathie und Sensibilität
Anti-Intrazeption ist eine Abwehr alles Subjektiven, Fantasievollen, Sensiblen. Intrazeption wäre dagegen die Anerkennung des Imaginären, von Wünschen, Gefühlen, Fantasien, Sehnsüchten, die auf subjektiven Einstellungen und ihrer Anerkennung beruhen. Wenn das Subjektive ausgelöscht werden soll, weil eine Ich-Schwäche danach verlangt, nicht zu sehr über Gefühle, Ambivalenzen, schwierige menschliche Emotionen nachzudenken, weil hier ein Kontrollverlust oder eine Infragestellung der eigenen Person und ihrer äußeren Fassade lauern könnte, dann kann von Anti-Intrazeption gesprochen werden. „Ohne Zugang zum Großteil seines Innenlebens, fürchtet er sich vor dem, was die Beschäftigung mit sich selbst oder die Beobachtungen anderer über ihn zum Vorschein bringen könnten. Daher mag er ‚Neugier‘ nicht, will er nicht wissen, was die Menschen fühlen und denken“. (Ebd., 54)
Dagegen steht eine Erziehung, die ein Verhalten fördert, sich in andere hineinzuversetzen, ihre Gefühle zu erfassen, gleich ihnen zu denken, Mitleid und Mitfreude zu empfinden, ohne immer alles teilen zu müssen, was andere wollen oder wünschen. Je mehr Empathie und Sensibilität wir für andere aufbringen können, desto ungeeigneter werden wir für antidemokratische Tendenzen sein, denn nichts müssten wir mehr fürchten als die Verweigerung ein Mensch mit eigenen Gefühlen und Wünschen zu sein. Gleichwohl ist hier viel Arbeit in den Beziehungen zu leisten, denn Empathie und Sensibilität sind ungleich verteilt und immer wieder setzen sich Diskriminierungen und Mobbing auch dort durch, wo wir mit mehr Verständnis gerechnet hätten. Viele Erzieher haben noch gar nicht begriffen, womit demokratische Einstellungen beginnen – mit der Empathie und der Sensibilität für die Andersartigkeit der Anderen.
zu 5) Aberglaube und Stereotypie versus Paradoxie, Ironie und Ambivalenz
Im Aberglauben mischen sich der Glaube an mystische Bestimmungen des eigenen Schicksals, an höhere Wirkkräfte des Lebens, an schicksalsgegebene Umstände. Die eigene Verantwortung vor den Dingen wird an äußere Kräfte abgegeben, eine Einschränkung der selbstbestimmenden Seite des Ich. Stereotypien drücken Vereinfachungen der Denkhaltung aus, die besonders starre Kategorien benötigen, um sich auszudrücken. Hier erscheinen wiederum Ich-Schwäche als auch ein Mangel an intelligentem Verhalten.
Aberglaube und Stereotypien haben in der post/modernen Welt nach wie vor einen großen Kundenkreis, denn zu übersichtlich und widersprüchlich ist die Welt für viele geworden, so dass sie sich nach einfachen Lösungen sehnen. Ob dies eine Art Dummheit darstellt, wie es bei Adorno anklingt, wenn er von einem Mangel an Intelligenz spricht, dies scheint mir das Problem weniger zu erfassen, denn Aberglauben findet sich in allen Schichten – auch den vermeintlich gebildeten. Eher scheint es heute ein Umgang mit drei Aspekten zu sein:
a) die Paradoxien der Postmoderne zu sehen und zu ertragen, ohne dadurch in einen Zweifel an Welt oder Ungerechtigkeit zu verfallen, sondern dass Widersprüchliche als einen Ausdruck der Unterschiedlichkeit unserer Konstrukte zu begreifen und zu verstehen, dass die Moderne uns illusionäre Versprechen gemacht hat, die die Postmoderne als Illusionen offenbart (vgl. dazu insbesondere Bauman);
b) eine ironische Haltung zu sich selbst einnehmen zu können, weil auch wir nicht konsequent alles das leben und machen können, was wir von den Zielen vielleicht wollen und vorgeben zu tun (z.B. umweltbewusst sein und doch Auto zu fahren);
c) Ambivalenzen zu leben, weil wir erkennen müssen, dass wir, indem wir das eine tun, das andere nicht zugleich erreichen können, weil wir einsehen müssen, dass jeder Erfolg auf der einen Seite eine verspielte Chance auf der anderen ist.
Menschen, die diese drei Seiten für sich entwickeln, denen wird es leichter fallen, eine demokratische Haltung einzunehmen, weil sie es gelernt haben, nicht nur andere, sondern dabei auch sich selbst mit in Frage zu stellen.
zu 6) Machtdenken und „Kraftmeierei“ versus Begrenzung hegemonialer Macht
Machtdenken und „Kraftmeierei“ sind Denkhaltungen, die sich besonders gerne erfolgreicher Dualismen bedienen, um die Welt zu erklären: Führer – Gefolgschaft, Herrschaft – Unterwerfung, stark – schwach, usw. „Oft arrangiert sich das Individuum, indem es sich Machtfiguren gleichstellt, so dass es beide Bedürfnisse zu befriedigen vermag, das nach Macht und das nach Unterwerfung.“ (Ebd., 57) Im Vordergrund dieser Haltung steht eine Identifizierung mit dem Stärkeren, mit Machtgestalten, die aufgrund ihrer Machtfülle auch den eigenen Weg weisen können. Auf der Ich-Seite werden dabei konventionelle Werte betont, die als Ausdruck der äußeren Herrschaft als übertriebene Zurschaustellung von Stärke und Robustheit auftreten.
Eine antidualistische Haltung, um die sich schon John Dewey in seinem Pragmatismus bemühte, ist sicherlich hilfreich für demokratisches Denken. Sie vermeidet zu starke Vereinfachungen, indem sie in den Handlungen das sehen will, was durch die Handlung geschieht. Hier ist heute, auch über Dewey hinaus, stärker darauf zu reflektieren, welche Mächte uns tatsächlich beherrschen und wie sie es tun. Jede Demokratie ist durch hegemoniale Kräfte gefährdet, die in ihr zu viel Macht gewinnen und durch diese Macht auch die Gewaltenteilung, die freien Wahlen, Menschenrechte außer Kraft setzen können. Auch hier – dies haben wir von Foucault gelernt – können wir uns selbst nicht aus der Machtfrage verabschieden, weil wir immer ein Teil von ihr sind. Aber zugleich benötigen wir kritische Analysen, die uns über tatsächliche Machtgefüge aufklären, weil die hegemonialen Kämpfe längst nicht nur auf politischer Ebene ablaufen, sondern vor allem im ökonomischen und sozialen Kapital agieren. Hier wird es bei einer zunehmenden Spaltung von arm und reich, von gebildet und ungebildet, zu einem Kampf um die Demokratie kommen, wobei die Demokratie nur gewinnen kann, wenn die Solidarität mit den Schwächeren hinreichend entwickelt wird und die gesellschaftliche Spaltung nicht ins Extrem getrieben wird, das so der Demokratie der Boden entzogen würde.
zu 7) Destruktivität und Zynismus versus Ressourcen- und Lösungsorientierung
Destruktivität und Zynismus sind für Adorno eine allgemeine Feindseligkeit und eine Diffamierung des Menschlichen. Antidemokratische Individuen hegen wegen der ihnen auferlegten Restriktionen zahlreiche aggressive Impulse, wie sie auch in der autoritären Aggression schon erschienen. Mit Destruktivität und Zynismus sind solche Aggressionen gemeint, die sich auf rationalisierte, nicht moralisierte Weise ausdrücken und vom Ich akzeptiert werden. Sie drücken sich in allgemeiner Menschenverachtung aus, in der Zustimmung zu totaler Aggression bei bereits nichtigen Anlässen, in einer generalisierten Feindseligkeit gegen Menschen bei gleichzeitigem Abstreiten eigener Verantwortung. Ein exemplarisches Beispiel für die rationale Kälte dieser Sicht mag das Bekenntnis des Lagerkommandanten von Auschwitz, Rudolf Höß, sein, der die massenhafte Vernichtung von Menschenleben als organisatorische Herausforderung sah.
Im globalisierten Kampf um die Welt hat der Kapitalismus nicht selten die Züge von Destruktivität und Zynismus, wobei dieser sich nicht nur auf Personen, sondern auf die Ressourcen dieser Welt selbst richtet. Adorno sah als Chance gegen Destruktivität und Zynismus eine Moral, die sich ein Gewissen über andere Menschen und die Welt errichtet hat, das auf Achtung des Lebens und der Ressourcen aus ist. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Nur die Deutbarkeit eines solchen Gewissens ist vielgestaltiger geworden, oft um Entschuldigungen für die unentschuldbaren Handlungen zu finden. Auch wenn der Konstruktivismus statt von universalisierten Wahrheiten oder Letztbegründungen nur noch von gerechtfertigten Behauptungen im Sinne Deweys spricht, so heißt dies nicht, dass alles beliebig geworden ist. Die Menschen und die Ressourcen zu achten, dies ist für unsere Zeit besonders gerechtfertigt, denn es ist Ausdruck und Wurzel eines demokratischen Verständnisses. Menschenrechte sind ein Konstrukt unserer Zeit, aber sie sind gerechtfertigt und für die Demokratie notwendig. Insoweit ist unsere Lösungsorientierung im Lösen der Probleme unserer Zeit abhängig von den Ressourcen, die wir bereits entwickelt haben, die wir verteidigen und fortentwickeln müssen. Dabei wird unser größtes Problem die Profitgier weniger sein, die auf Kosten der Mehrheit alles tun, um Gewinne zu maximieren, ohne sich darum zu scheren, was dies für die Menschen, die Umwelt und Ressourcen bedeutet. Dies ist die Destruktivität und der Zynismus unserer Zeit, den wir begrenzen müssen, um zu demokratischen Lösungen zu kommen. Aber auch diese Lösungen setzen nicht nur bei äußeren Gegnern an, sondern beginnen bei uns, stecken bereits in unseren Handlungen und haben sich in vieles eingeschrieben, von dem wir eben noch dachten, es sei gar nicht unser Problem. Die Rationalisierung und ihren verdeckten Zynismus auch in den eigenen Handlungen zu erkennen und den Mut für alternative Lösungen zu finden, ist eine wesentliche Herausforderung.
zu 8) Projektivität versus Perspektivität
Projektivität, das ist für Adorno eine Disposition, die überall in der Welt wüste und gefährliche Vorgänge vermutet. Eigene unbewusste Triebimpulse werden auf die Außenwelt unter Abwehr der eigenen Wünsche projiziert. Dabei werden eigene, unterdrückte Impulse, auf andere übertragen und dann an diesen bestraft. Nehmen wir die Variablen im Zusammenhang, dann ist Projektivität die Variable, die am deutlichsten in allen anderen vorzukommen scheint.
Projektivität ist eine von Freud geprägte Theorie, die sich ohne an Freud anzuschließen (was immer eine interessante Möglichkeit ist) konstruktivistisch auch als Perspektivität bezeichnen ließe. Wir nehmen immer bestimmte Perspektiven als Beobachter ein, um unsere Welt zu konstruieren. Aber als Akteure erkennen wir auch, dass in diesen Perspektiven bestimmte Vorannahmen stecken, bestimmte Teilnahmen, die wir agieren.
Wichtig für den interaktionistischen Konstruktivismus ist es, dass wir nicht nur Perspektiven von anderen übernehmen, sondern eine Perspektivenvielfalt entwickeln:
a) uns in die Perspektiven anderer, sehr unterschiedlicher Menschen und Gruppen hineinversetzen können, sie für uns nachvollziehen können, um sie in ihren Ausgangslagen und Interessen zu verstehen und nachempfinden zu können, was sie warum wollen;
b) Perspektiven von anderen dann übernehmen, wenn wir uns kritisch eine eigene Meinung haben bilden können oder sie wieder ändern oder ergänzen, wenn wir erst später verstanden haben, welche Kritik uns noch fehlte;
c) eigene Perspektiven entwickeln, die wir jedoch nie für universal oder abschließend halten, weil wir wissen, dass es andere Perspektiven gibt und wir und unsere Verständigungsgemeinschaft auch irren können oder eigene Interessen verfolgen;
d) jene Perspektiven ablehnen und bekämpfen, die behaupten, nur sie hätten die Wahrheit für alle anderen gefunden.
zu 9) übertriebene Beschäftigung mit Sexualität versus Sex and Gender
Eine übertriebene Beschäftigung mit Sexualität äußerst sich darin, dass insbesondere ich-fremde Sexualität (Homosexuelle, Sittlichkeitsverbrecher, Andersdenkende) verfolgt werden. „Wo bereitwillig an ‚Sexorgien‘ geglaubt wird, besteht wahrscheinlich generell die Tendenz, die Realität durch Projektion zu verzerren; sexuelle Inhalte würden aber kaum projiziert werden, wenn das Individuum nicht gleiche, ihm nicht bewusste und stark aktive Impulse hätte.“ (Ebd., 61)
Im Gegensatz zu den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, auf das Adorno sich bezieht, hat die Sexualität heute ein viel diverseres, differenziertes und von einengenden Projektionen freieres Bild angenommen. Sexualität wird in der Regel in demokratischen Kulturen offener diskutiert, und Homosexualität ist kein Tabu mehr und oft bereits breit als Lebensform anerkannt. Gleichwohl ist die Andersartigkeit der Anderen immer wieder Thema und gewaltvolle Übergriffe in der Sexualität sind nach wie vor Projektionsflächen. Eine besondere Entdramatisierung der projektiven Beschäftigung mit Sexualität, wie sie Adorno noch vor Augen hatte, bietet der durch den Feminismus eingeführte Diskurs von Sex und Gender, der besonders in den Arbeiten von Judith Butler aufgewiesen hat, inwiefern biologisches und kulturelles Geschlecht voneinander geschieden sind und wo sie zusammenwirken. Gendertheorien, die das kulturelle Konstrukt bezeichnen, sind außerordentlich wichtig geworden, ein differenziertes Bild der kulturbezogenen Sexualität über die biologische Sicht hinaus zu entwickeln, das insbesondere die konstruktive Seite von Wirklichkeitsbildungen zeigt. In ihnen liegt zugleich ein hohes demokratisches Potenzial, das bisher in der Erziehung noch zu wenig genutzt wird, um gegen einseitige Projektivität zu wappnen. Je mehr wir erkennen können, wie auch wesentliche Funktionen unseres Lebens, wie in der Sexualität, Konstrukte der Lebenswelt sind, desto mehr werden wir gegen Sündenbocktheorien oder Vereinnahmungen durch vereinfachende Weltbilder sein.
Insgesamt versuchte ich in dieser Interpretation zu zeigen, wie Beziehungen und Lebenswelt dicht verknüpft sind, wenn wir uns mit antidemokratischen oder demokratischen Orientierungen und Haltungen befassen. In den konkreten Beziehungen und Haltungen liegen stets die Bedingungen auch für das Gelingen oder Misslingen von Demokratie. Fasse ich dies abschließend zusammen, so erscheinen mir folgende Aspekte noch einmal hervorhebenswert:
- So wie es in den großen gesellschaftlichen Ereignissen immer ungünstig sein wird, hegemoniale Macht zu erfahren, so wird dies auch im kleinsten System solcher gesellschaftlichen Welten zu negativen und bekämpfenswerten Grenzerfahrungen führen, gegen die wir gar nicht energisch genug unsere eigene Mächtigkeit zu setzen haben.
- Allerdings sollte dies für uns eine beobachtbare, keine willkürliche Grenze sein, die wir durch das eigene Nomadisieren unserer Blicke, durch multiples und differentes Schauen selbst erlernt haben. Und es ist keine isolierte oder isolierende Grenze, sondern immer die eines Austausches über Verständigung und damit eine gemeinschaftliche. Sie tritt in den Zirkel der Mächtigkeit relativ autonomer Subjekte, die darüber die Regeln der Zirkularität von Macht untereinander definieren. Oft bedarf es des Blicks eines Dritten (mitunter eines Therapeuten), solche Grenzerfahrungen in Krisen besser beobachten zu können.
- Jedoch wird durch die Territorialverwaltungen von Wahrheit und Lebensauffassungen unsere Sozialisation immer schon durch die Grenzen bestimmt, die andere als Macht gesetzt haben. Es wird zum energischen Kampf gehören müssen, alle uniformierten, dogmatisierten und auf aufgeklärte oder aufklärbare Wahrheit pochenden Bezüge zu relativieren und die eigene Mächtigkeit hierin als vagabundierende und verunsicherte Beobachtung noch kräftig genug zu halten, so dass sie Spaß an der Vielgestaltigkeit und Abscheu gegenüber der Vereinnahmung durch ein bloßes Eins oder gleichgültiges bzw. abstoßendes Einerlei empfindet.
- Die konstruktivistischen Freiheiten werden in sozialen Praktiken, Routinen und Institutionen offensichtlich durch eine Ethik begrenzt, deren Grundlagen zumindest in einer negativen Ausgrenzung von Übergriffen gegen Andere bestehen: Gegen Gewalt, Verdinglichung, Übergriffe auf ein Mindestmaß an Selbstbestimmung. Aber diese Ethik können wir nicht als universale Mächtigkeit formulieren, sondern immer nur aus der Mächtigkeit einer lebendigen, einer aktiven Verständigungsgemeinschaft, die sich aus den selbstbestimmten Einsichten der Mehrheit ihrer Mitglieder hierauf zu einigen hat. Eine re/de/konstruktivistische Arbeit in diesem Bereich sollte sich aber auch als aktive Beeinflussung im Sinne einer Sicherung einer möglichst großen Freiheit einzelner Beobachterperspektiven, möglichst hoher Gleichheit der Anerkennung von Beobachterpositionen, der Vermeidung hegemonialer Machtstrukturen und der ständigen Aufdeckung von Macht in allen Verhältnissen (zur kritischen Bewusstmachung), der Sicherung von Beobachtervielfalt und der Anerkennung auch von Minderheitenpositionen entwickeln. Dabei greifen allerdings keine Konzepte der Universalisierung, keine transhistorischen Verallgemeinerungen, sondern nur an den Praktiken, den vorhandenen Routinen und Institutionen orientierte Bearbeitungen, die ihren Ausgangspunkt in den Handlungen jedes einzelnen nehmen.
- Damit wird die eigene Mächtigkeit zu einem Wert, der durchaus Mächte impliziert. Um solche Mächte vor der Macht zu hüten, die hegemonial und trotzig sich aufrichtet, um gottgleich oder -nah zu schauen, um patriarchalisch zu dominieren, um Gewalt auszuüben und den Anderen zu drangsalieren statt zu respektieren, wird man sie ständig dezentralisieren, enthierarchisieren und in sich selbst reflektiert begrenzen müssen. Ihr Widerspruch jedoch ist, dass dies nach Bescheidenheit in einem Zeitalter der Unbescheidenheit verlangt.
1 Vgl. zu diesen Unterscheidungen des kulturellen Kapitals die Sondernummer von „Sociologie et sociétés“ (Oktober 1989). Im inkorporierten Zustand existiert das kulturelle Kapital in Form von dauerhaften Dispositionen des Körpers; im objektivierten Zustand in Form kultureller Güter (Bücher, Lexika, Bilder, Instrumente, Maschinen usw.), in denen bestimmte Theorien oder Kritiken dieser Theorien erscheinen und sich verwirklichen; im institutionalisierten Zustand erscheint das Kapital in einer Sonderform von Objektivation, die sich z.B. durch Titelvergabe äußert. Vgl. auch Bourdieu (1992 a, 49 ff.).
2 Im Blick auf die chinesische Antike haben wir dies Verfahren als sehr konstruktiv erfahren. Vgl. Reich/Wei (1997).
3 Vgl. als Einführung insbesondere Eribon (1993), Schmid (1991), Ewald/Waldenfels (1991).
4 Vgl. dazu auch Habermas (1991 a, 281). Habermas macht darauf aufmerksam, dass Foucault die Romantik aus dem Spektrum der ihn beeinflussenden Grenzüberschreitungen ausgespart hat.
5 Zum Vergleich von Foucault und Kritischer Theorie vgl. bes. McCarthy (1993, 64 ff.).
6 Honneths (1989, 121 ff.; 1990, 73 ff.) Analyse versucht diesen Gesichtspunkt differenziert herauszuarbeiten. Seine Interpretation Foucaults erscheint mir aber oft als zu einseitig, da er Foucault überwiegend benutzt, um sein an Habermas orientiertes Modell zu bestätigen und so Foucault zu sehr vereinfacht. Dies gilt auch für McCarthy (1993), wie weiter unten noch zu diskutieren sein wird. Aus interaktionistisch-konstruktivistischer Sicht vgl. Dahlmanns (2008).
7 Dies bedingt auch seine Distanz zur Psychoanalyse, obwohl er ihre Denkweisen teilweise doch als Stützpunkt benötigte; vgl. weiterführend z.B. Foucault (1978, 118 ff.), Miller (1991).
8 Zur Besonderheit der Foucaultschen Perspektiven über den Strukturalismus hinaus vgl. z.B. auch Habermas (1991 a, 279 ff.). In Band 1 bin ich mehrfach bereits auf Foucault eingegangen, vgl. insbesondere Kapitel I und Kapitel II.1.3.4.2.
9 In der konstruktivistischen Diskurstheorie wird der Machtaspekt als ein durchgängiger Analysepunkt aufzunehmen sein. Vgl. dazu Kapitel IV.4.
10 Die nähere Begründung und Kritik dieser Herleitung soll hier nicht weiter verfolgt werden; vgl. z.B. Habermas (1991 a, 300 ff.), Honneth (1989). Grenzen dieser Kritik wurden schon markiert. Vgl. erweiternd auch Waldenfels, der Foucault für eine radikalisierte Phänomenologie umdeutet (1991, dort weitere Literaturangaben).
|
|
>> zurück zum Inhaltsverzeichnis und zur Auswahl der Kapitel |
|
|